Anders als die Bundesregierung es anzustreben scheint, ist eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) nötig. Die Schuldenabbauregel zwingt hochverschuldete Euroländer zu einem zu schnellen und zu wachstumsschädlichen Schuldenabbau.
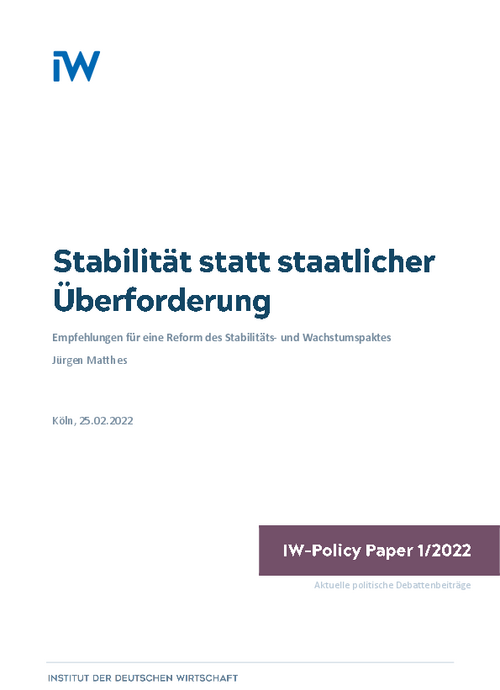
Stabilität statt staatlicher Überforderung

Anders als die Bundesregierung es anzustreben scheint, ist eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) nötig. Die Schuldenabbauregel zwingt hochverschuldete Euroländer zu einem zu schnellen und zu wachstumsschädlichen Schuldenabbau.
Nur auf die Flexibilität des Pakts zu setzen, würde Ausnahmetatbestände zu stark überdehnen. Zudem würde der Europäischen Kommission die ihr angedachte Rolle als Hüterin der Verträge unmöglich gemacht. „Brüssel“ würde dadurch weiter geschwächt. Folgende Reformschritte werden empfohlen: Der Schwellenwert von 60 Prozent des BIP für den öffentlichen Schuldenstand ist beizubehalten, aber die Schuldenabbauregel sollte bei unabweisbarem Bedarf über den Horizont von 20 Jahren hinaus gestreckt werden können. Das Drei-Prozent-Defizitkriterium gilt es aufgrund seiner Signalwirkung ebenfalls zu bewahren. Dagegen sollte die Zielgröße des strukturellen Defizits aufgrund von Messproblemen durch eine neue mittelfristig orientierte Ausgabenregel (weitgehend) ersetzt werden. (Grün) goldene Regeln, also Ausnahmen von den Defizitregeln besonders für grüne Investitionen, sind aus verschiedenen Gründen kritisch zu sehen. Geldbußen bei Verstößen sollten erhalten bleiben, aber noch stärker durch mildere und leichter anwendbare Sanktionen ergänzt werden.
In der Debatte über den SWP wird immer wieder gefordert, den Pakt aufzuweichen und großzügige Regeln für vielfältige investive Staatsausgaben zu schaffen. Doch diese Diskussion kann nicht losgelöst von den Herausforderungen dieser Dekade geführt werden. Daher lautet die Kernthese dieser Studie: Ein funktionsfähiger SWP ist unverzichtbar, weil in der EU eine staatliche Überforderung und strategische Überdehnung auf Kosten der Finanzstabilität droht. Die EU läuft in einen Zielkonflikt hinein zwischen ihren hohen Ambitionen (in Sachen Dekarbonisierung, Digitalisierung und strategischer Autonomie) und deren stabilitätsgerechter Finanzierbarkeit in den hochverschuldeten Staaten. Dies betrifft zwar vor allem die verwundbaren Euroländer, doch die Euro-Schuldenkrise lehrt, dass Ansteckungseffekte einer Staatsschuldenkrise letztlich die gesamte EWU gefährden könnten. Käme es zu einer solchen Krise, könnte die EU ihre Ziele weitgehend abschreiben. Das schwächste Glied der Kette bestimmt deren Spannkraft. Daher muss die Stabilitätssicherung oberste Priorität haben – und durch einen reformierten SWP als Vertrauensanker unterfüttert werden. Immer höhere Ansprüche an den Staat, die allenthalben aufkommen, sind dem unterzuordnen.
Stabilitätsgefahren drohen hauptsächlich, weil die Corona-Krise die Schuldenstände stark erhöht hat und noch weiterhin bremsend nachwirkt. Zudem muss die EZB wegen höherer Inflation aus der ultraexpansiven Geldpolitik und den Staatsanleihekäufen aussteigen, was Unruhe an den Finanzmärkten schaffen wird. Hinzu kommt: Die vier großen Trends dieses Jahrzehnts steigern die Risiken für die Schuldentragfähigkeit in den hochverschuldeten Euroländern in dieser Dekade zusätzlich. Demografie, Dekarbonisierung, Digitalisierung, und „De-Globalisierung“ (in Form von Protektionismus, Reshoring und einer neuen Industriepolitik zur Steigerung der strategischen Autonomie der EU) erhöhen die Staatsausgaben und haben in der Gesamtschau tendenziell negative Wachstumswirkungen. Vor allem die Demografie wirkt stark bremsend. Die grüne Transformation hat bestenfalls marginal positive Wachstumseffekte, doch auch negative sind nicht ausgeschlossen. Zwar wirken klimaschonende Investitionen positiv, doch dürften in klimaschädlicheren Bereichen Wertschöpfung und Investitionen wegbrechen oder zumindest sehr viel schwächer wachsen. Die grundsätzlich positiven Wachstumswirkungen der Digitalisierung materialisieren sich bislang kaum. Und die Effekte der verschiedenen Facetten der „De-Globalisierung“ können allenfalls kurzfristig positiv wirken, werden mittelfristig aber die Produktivitätsentwicklung dämpfen, weil Spezialisierungsvorteile verloren gehen. Zudem könnte der Realzins bei höherer Investitionstätigkeit steigen und somit die Schuldentragfähigkeit zusätzlich gefährden und das Argument für investive Staatsausgaben im Niedrigzinsumfeld schwächen.
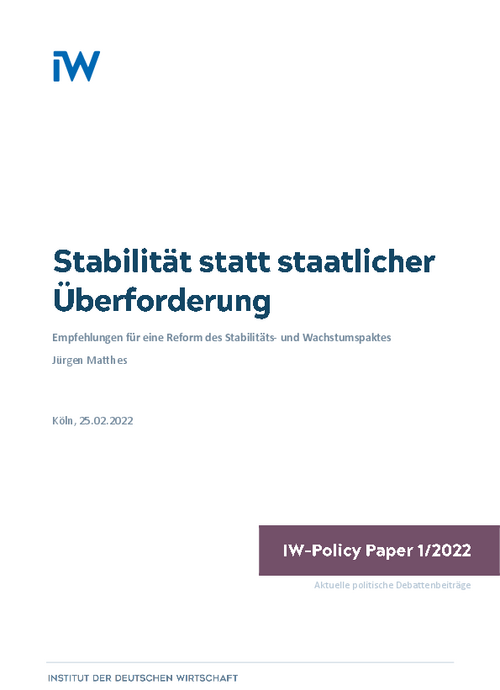
Stabilität statt staatlicher Überforderung


Inflation in der Eurozone: Der Weg bleibt holprig
Die Inflation in der Eurozone befindet sich auf dem Rückzug. Ein Aufatmen wäre aber verfrüht. Zweitrundeneffekte im Arbeitsmarkt sind im vollen Gange und setzen die Geldpolitik weiter unter Druck.
IW
Trump oder Harris oder …? Worauf sich Europa einstellen muss
Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Donald Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl. Auf Seiten der Demokraten hat der amtierende Präsident seine Kandidatur nach langem Zögern zurückgezogen, Vizepräsidentin Kamala Harris wird mit hoher ...
IW