Als Konjunktur wird die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage bezeichnet. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft nicht gleichmäßig, sondern in unstetig wiederkehrenden Wellenbewegungen, die Konjunkturzyklen genannt werden. Diese können durch Nachfrage-, Angebots- und Politikschocks erklärt werden. Explodierende Rohstoffpreise, Finanzmarktkrise oder Protektionismus kann einzelne Länder oder gar die Weltwirtschaft in eine Rezession schicken. Der erste Lockdown während der Corona-Pandemie hat sogar zu einem Nachfrage- und gleichzeitigen Angebots-Schock geführt: Läden mussten schließen und viele Unternehmen konnten aufgrund von Problemen innerhalb ihrer Lieferketten nur wenig produzieren. Konjunkturpolitik zur Stabilisierung der Wirtschaft ist seit jeher ein kontroverses Thema in den Wirtschaftswissenschaften. Dabei hilft eine umfassende Analyse der Auslöser der jeweiligen Krisen, um situationsgerecht und zeitnah zu reagieren.
- Home
- Themen
- Wachstum und Konjunktur
- Konjunktur
Konjunktur

Über das Thema
Konjunkturzyklen sind das Ergebnis von positiven und negativen Schocks. Der technische Fortschritt beispielsweise kann einen Aufschwung hervorrufen, explodierende Ölpreise hingegen einen Abschwung (Angebotsschocks). Eine Aufwertung der eigenen Währung schwächt den Export und kann so eine wirtschaftliche Talfahrt einläuten, umgekehrt können positive Erwartungen der Unternehmen die Investitionsnachfrage steigern und zum Aufschwung führen (Nachfrageschocks). Auch die Politik kann Konjunkturschwankungen auslösen.
In schlechten Zeiten neigt die Politik dazu, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage mit kreditfinanzierten Staatsausgaben zu stützen. Oftmals wird dabei versucht, kurzfristig den Konsum zu beleben. Sinnvoller wären aber Maßnahmen, die zugleich kurzfristig die Nachfrage und langfristig das Wachstumspotenzial stärken – etwa durch Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Doch jede schuldenfinanzierte Konjunkturpolitik birgt die Gefahr, dass die Schulden nicht getilgt werden, wenn die Wirtschaft wieder läuft.


Konjunkturampel: Die deutsche Wirtschaft verharrt in der Stagnation
Für die deutsche Industrie ist keine Trendwende in Sicht – anders als für die Dienstleistungsbranche, schreibt IW-Konjunkturexperte Michael Grömling für die VDI-Nachrichten.
Michael Grömling in den VDI-Nachrichten IW

IW-Konjunkturumfrage Frühjahr 2024: Unternehmen sehen keine Erholung in 2024
Die Ergebnisse der IW-Konjunkturumfrage vom Frühjahr 2024 zeigen, dass sich die Geschäftslage der deutschen Unternehmen seit dem Herbst 2023 nicht verbessert hat.
Michael Grömling IW

Konjunkturumfrage: Unternehmen bewerten Lage noch schlechter als vor einem Jahr
Auch für 2024 rechnen die deutschen Unternehmen nicht damit, dass sich die Wirtschaft erholt, zeigt die neue Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Lage und die Erwartungen für 2024 sind insgesamt schlecht, das macht sich bei ...
Michael Grömling IW

Fakten zu Frankreich
Bon à savoir: Sieben interessante Details über Deutschlands Nachbarn und wichtigsten Partner in der Europäischen Union.
Berit Schmiedendorf iwd
Unsere Experten

Prof. Dr. Michael Grömling
Leiter des Clusters Makroökonomie und Konjunktur
Tel: 0221 4981-776 Mail: groemling@iwkoeln.deAlle Beiträge

Konjunkturampel: Die deutsche Wirtschaft verharrt in der Stagnation
Für die deutsche Industrie ist keine Trendwende in Sicht – anders als für die Dienstleistungsbranche, schreibt IW-Konjunkturexperte Michael Grömling für die VDI-Nachrichten.
Michael Grömling in den VDI-Nachrichten IW
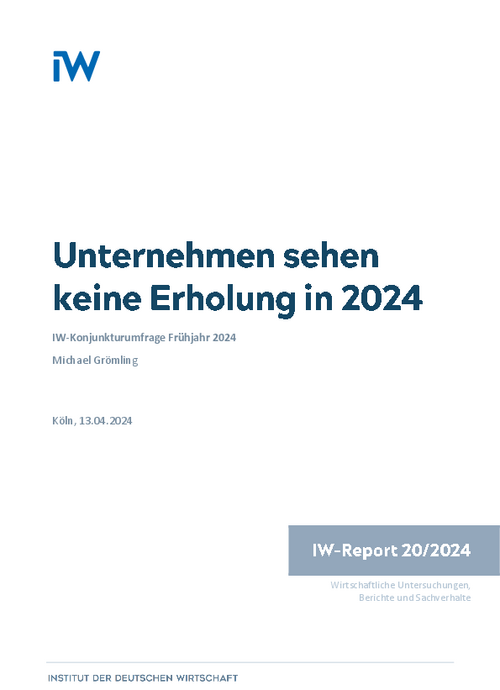
IW-Konjunkturumfrage Frühjahr 2024: Unternehmen sehen keine Erholung in 2024
Die Ergebnisse der IW-Konjunkturumfrage vom Frühjahr 2024 zeigen, dass sich die Geschäftslage der deutschen Unternehmen seit dem Herbst 2023 nicht verbessert hat.
Michael Grömling IW

Konjunkturumfrage: Unternehmen bewerten Lage noch schlechter als vor einem Jahr
Auch für 2024 rechnen die deutschen Unternehmen nicht damit, dass sich die Wirtschaft erholt, zeigt die neue Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Lage und die Erwartungen für 2024 sind insgesamt schlecht, das macht sich bei Investitionen bemerkbar – in manchen Unternehmen droht ein Beschäftigungsabbau.
Michael Grömling IW

Fakten zu Frankreich
Bon à savoir: Sieben interessante Details über Deutschlands Nachbarn und wichtigsten Partner in der Europäischen Union.
Berit Schmiedendorf iwd

Fußball-EM 2024: Kein konjunkturelles Sommermärchen
Deutschland steckt tief in der Rezession und die Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland den rettenden volkswirtschaftlichen Impuls bringen? Nein, meint Michael Grömling, Konjunkturexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Gleichzeitig dürfe man die psychologische Wirkung auf die Wirtschaft nicht unterschätzen.
Michael Grömling IW
Ihre Suche lieferte einen fehlerhaften Status zurück. Möglicherweise haben Sie zu viele Filter ausgewählt. Sie können zurück zu Ihrer vorherigen Auswahl springen, um Ihre Suche anzupassen.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.
Monatlich verschicken wir unsere themenspezifischen Newsletter.
Hier geht's zur Anmeldung.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.
