In Deutschland greift der Staat stark in die ursprüngliche Einkommensverteilung ein und reduziert so die Einkommensungleichheit. Einerseits zahlt die öffentliche Hand Sozialleistungen wie Kindergeld, Renten, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Andererseits erhebt der Staat Steuern und Sozialabgaben – je höher das Einkommen, desto mehr muss der Bürger in der Regel an den Fiskus bezahlen. Das oberste Zehntel der Einkommensbezieher schultert mehr als die Hälfte der Einkommenssteuerlast. Das untere Fünftel zahlt so gut wie gar keine Einkommenssteuer, bezieht aber einen Großteil der staatlichen Transfers.
- Home
- Themen
- Verteilung und öffentliche Finanzen
- Einkommensverteilung
Einkommensverteilung

Über das Thema
Zu viel Umverteilung kann jedoch einen unerwünschten Effekt haben: Die Leistungsträger werden sich kaum ins Zeug legen, wenn der Staat sie über Gebühr belastet. Nur wenn harte Arbeit, Wissen und Fähigkeiten ausreichend belohnt werden, entsteht ein Anreiz, in die eigene Bildung und die der Kinder zu investieren. Letztlich ist auch den Einkommensschwächeren gedient, wenn die Leistungsbereitschaft der Starken erhalten bleibt. Denn in einer wachsenden Volkswirtschaft verbessern sich in der Regel auch die Einkommens- und Erwerbschancen der unteren Schichten.
Die Wissenschaftler des Kompetenzfelds beschäftigen sich eingehend mit der Frage, wie sich die Coronakrise auf die Einkommensungleichheit in Deutschland auswirkt. Zumindest im ersten Lockdown 2020 haben Staatseingriffe eine steigende Ungleichheit verhindert, wie eine IW-Studie zeigte. Wie diese Entwicklung weitergeht, hängt von vielen strukturellen Faktoren ab, etwa wie gut einzelne Branchen, Regionen und Einkommensgruppen aus der Coronakrise herauskommen.


Wer im Alter arbeitet, ist zufriedener
IW-Expertin für soziale Sicherung und Verteilung, Ruth Maria Schüler, geht in einem Gastbeitrag für die Fuldaer Zeitung der Frage nach, warum der frühe Ausstieg aus dem Erwerbsleben kein Garant für das Lebensglück ist.
Ruth Maria Schüler in der Fuldaer Zeitung IW

Inflation: Rentner nicht stärker betroffen als andere Haushalte
Die Kaufkraft von Rentnern der Gesetzlichen Rentenversicherung sank in den vergangenen Jahren nicht stärker als bei anderen Haushalten. Während die Coronapandemie Rentner nicht so stark getroffen hat, führten die Preissteigerungen spätestens seit 2022 zu ...
Martin Beznoska / Judith Niehues / Ruth Maria Schüler / Maximilian Stockhausen IW

Bürgergeld und Preisentwicklung
Die Preise stiegen zuletzt langsamer. Derzeit ist die Kaufkraft der Grundsicherung höher als vor vier Jahren. Regelbasiert bliebe die Grundsicherung im Wahljahr 2025 voraussichtlich unverändert. Die Politik sollte dennoch Ruhe bewahren und sich an die selbst ...
Holger Schäfer / Christoph Schröder / Stefanie Seele IW

Makroökonomische Analyse von Lohn-Preis-Spiralen
Gegenstand der vorliegenden Analyse ist die Frage, wie Lohn-Preis-Spiralen die makroökonomische Stabilität und Inflationsentwicklung in Deutschland beeinflussen und in welcher Form sie auftreten können.
Thomas Obst / Maximilian Stockhausen IW
Unsere Experten

Dr. Björn Kauder
Senior Economist für Finanz- und Steuerpolitik
Tel: 0221 4981-516 Mail: kauder@iwkoeln.de
Dr. Judith Niehues
Leiterin des Clusters Mikrodaten und Verteilung
Tel: 0221 4981-768 Mail: niehues@iwkoeln.de
Christoph Schröder
Senior Researcher für Einkommenspolitik, Arbeitszeiten und -kosten
Tel: 0221 4981-773 Mail: schroeder.christoph@iwkoeln.de
Dr. Maximilian Stockhausen
Senior Economist für Soziale Sicherung und Verteilung
Tel: 030 27877 134 Mail: stockhausen@iwkoeln.de Maximilian Stockhausen @StockhausenEconAlle Beiträge

Wer im Alter arbeitet, ist zufriedener
IW-Expertin für soziale Sicherung und Verteilung, Ruth Maria Schüler, geht in einem Gastbeitrag für die Fuldaer Zeitung der Frage nach, warum der frühe Ausstieg aus dem Erwerbsleben kein Garant für das Lebensglück ist.
Ruth Maria Schüler in der Fuldaer Zeitung IW

Inflation: Rentner nicht stärker betroffen als andere Haushalte
Die Kaufkraft von Rentnern der Gesetzlichen Rentenversicherung sank in den vergangenen Jahren nicht stärker als bei anderen Haushalten. Während die Coronapandemie Rentner nicht so stark getroffen hat, führten die Preissteigerungen spätestens seit 2022 zu erheblichen Belastungen für alle Haushalte, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt.
Martin Beznoska / Judith Niehues / Ruth Maria Schüler / Maximilian Stockhausen IW
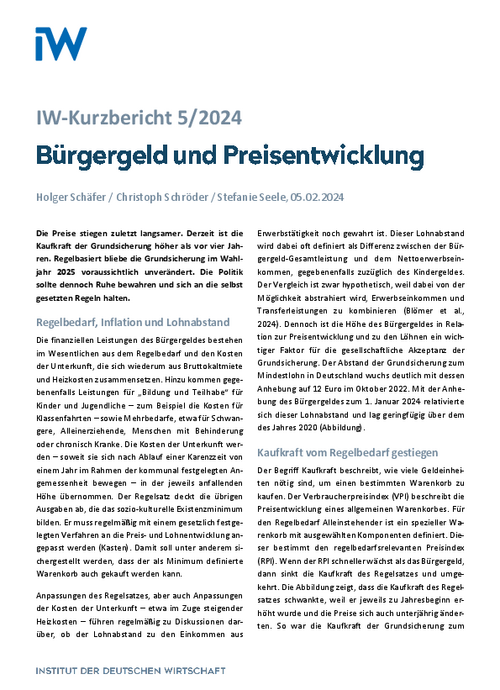
Bürgergeld und Preisentwicklung
Die Preise stiegen zuletzt langsamer. Derzeit ist die Kaufkraft der Grundsicherung höher als vor vier Jahren. Regelbasiert bliebe die Grundsicherung im Wahljahr 2025 voraussichtlich unverändert. Die Politik sollte dennoch Ruhe bewahren und sich an die selbst gesetzten Regeln halten.
Holger Schäfer / Christoph Schröder / Stefanie Seele IW
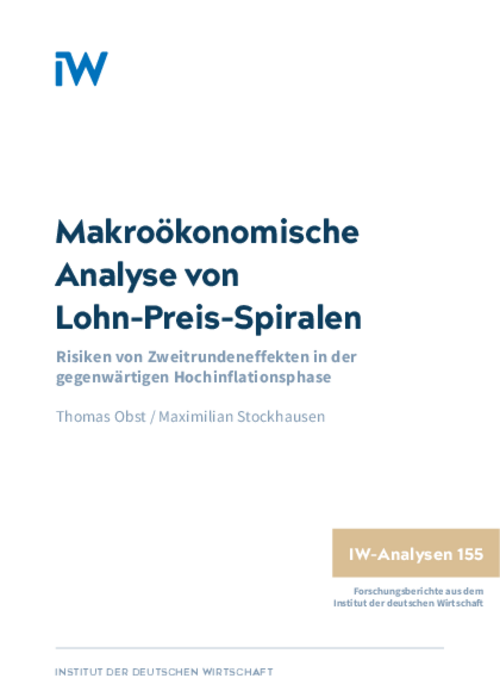
Makroökonomische Analyse von Lohn-Preis-Spiralen
Gegenstand der vorliegenden Analyse ist die Frage, wie Lohn-Preis-Spiralen die makroökonomische Stabilität und Inflationsentwicklung in Deutschland beeinflussen und in welcher Form sie auftreten können.
Thomas Obst / Maximilian Stockhausen IW
Verteilungs- und Sozialpolitik: Ist mehr besser? Sinkendes Gerechtigkeitsempfinden in Zeiten wachsender Sozialausgaben
Trotz merklich angestiegener Sozialstaatsausgaben wird die soziale Ungleichheit in Deutschland von breiten Bevölkerungsschichten weiterhin als zu hoch empfunden.
Knut Bergmann / Matthias Diermeier IW
Ihre Suche lieferte einen fehlerhaften Status zurück. Möglicherweise haben Sie zu viele Filter ausgewählt. Sie können zurück zu Ihrer vorherigen Auswahl springen, um Ihre Suche anzupassen.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.
Monatlich verschicken wir unsere themenspezifischen Newsletter.
Hier geht's zur Anmeldung.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.
