Deutschland, Österreich und die Schweiz sind vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen, um ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.
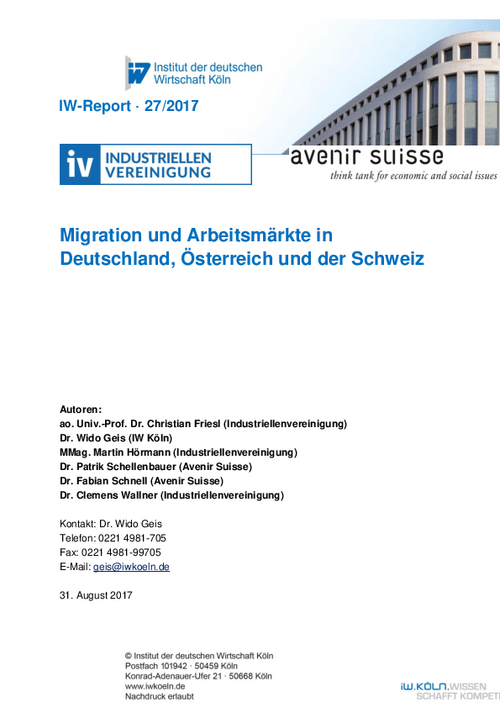
Migration und Arbeitsmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz
IW-Report

Deutschland, Österreich und die Schweiz sind vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen, um ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.
So kommen in Deutschland nur 60,7 Personen zwischen 10 und 19 Jahren auf 100 Personen zwischen 50 und 59 Jahren. In Österreich sind es 67,2 und in der Schweiz 68,9. Gleichzeitig handelt es sich bei bedeutenden Teilen der Bevölkerungen in den drei Ländern bereits heute um Zuwanderer. So ist in Deutschland jeder siebte, in Österreich fast jeder fünfte und in der Schweiz deutlich mehr als jeder vierte Einwohner nicht im Land geboren. Dabei war die Zuwanderung in die drei Länder in der Vergangenheit sehr stark von Personen aus den (anderen) EU-Ländern getragen, die selbst zunehmend vom demografischen Wandel betroffen sind, sodass die Migrationspotenziale hier beschränkt sein dürften. Hinzugekommen ist in den Jahren seit 2014 eine große Zahl an Flüchtlingen, die aufgrund eines häufig sehr ungünstigen qualifikatorischen Hintergrunds und der Sprachbarriere allerdings sehr schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Obschon sich die institutionellen Rahmenbedingungen teilweise unterscheiden, gilt daher für alle drei Länder gleichermaßen, dass die Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten gestärkt werden muss.
Zuwanderung kann ihre wirtschaftlichen Potenziale allerdings nur voll entfalten, wenn die ins Land kommenden Personen zügig und gut auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, was im Hinblick auf Drittstaatenangehörige von außerhalb des EU-/EFTA-Raums in den drei Ländern nicht immer der Fall war. So liegen die Arbeitslosenquoten von Nicht-EU-Ausländern in Deutschland bei 11,8 Prozent, in Österreich bei 13,9 Prozent und in der Schweiz bei 13,5 Prozent. Gelingt die Arbeitsmarktintegration nicht, kann Zuwanderung auch zu einer substanziellen Belastung für das Zielland werden. Dies gilt in besonderem Maße, aber nicht ausschließlich im Hinblick auf die große Zahl der Flüchtlinge. Wichtig ist in diesem Kontext, dass die ins Land kommenden Personen möglichst zeitnah nach der Ankunft Zugang zum Arbeitsmarkt und zu passenden (Nach-) Qualifizierungsangeboten erhalten und eine Erwerbstätigkeit gefördert und gefordert wird.
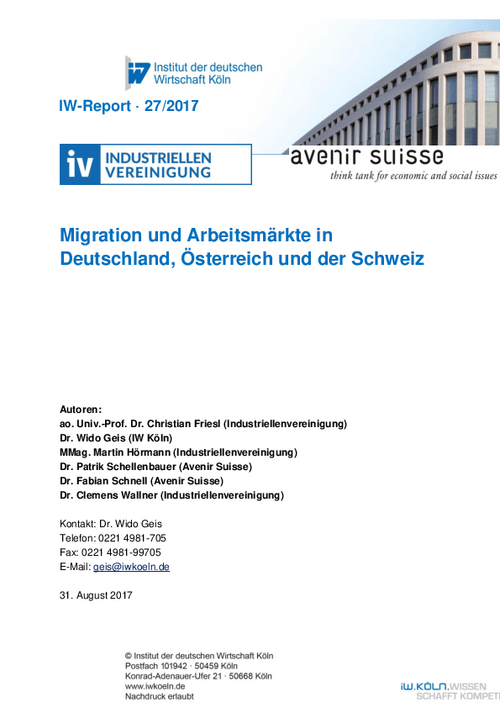
Christian Friesl / Wido Geis / Martin Hörmann / Patrik Schellenbauer / Fabian Schnell / Clemens Wallner: Migration und Arbeitsmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz
IW-Report


Steuerrabatte für Ausländer: Jährliche Kosten von 600 Millionen Euro
Die Debatte um Steuervergünstigungen für ausländische Fachkräfte erhitzt weiter die Gemüter. Die Steuergeschenke würden nach neuen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bis zu 600 Millionen Euro kosten – und dabei wenig bringen.
IW
Steuerrabatte für ausländische Fachkräfte sind keine Lösung
Mit Steuervergünstigungen will die Bundesregierung ausländische Fachkräfte nach Deutschland locken. Damit verfolgt sie das richtige Ziel, setzt aber an der falschen Stelle an. Vor allem zu lange Visumverfahren bremsen den Zuzug nach Deutschland aus.
IW