Seitdem in allen Bundesländern die Kitas und Schulen im Zuge der Corona-Krise geschlossen haben, müssen alle Kinder zu Hause weiter gefördert werden. Sollten die Schließungen und Homeschooling längere Zeit andauern, dürften sich die bereits in den letzten Jahren zunehmenden Probleme bei der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland weiter verschärfen.
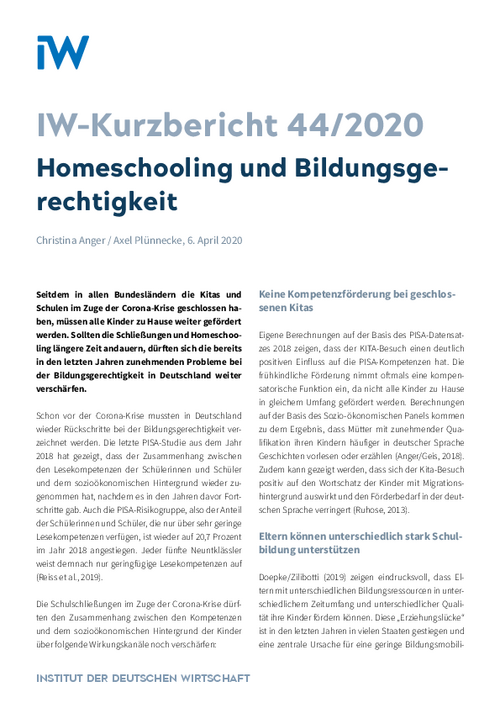
Homeschooling und Bildungsgerechtigkeit
IW-Kurzbericht

Seitdem in allen Bundesländern die Kitas und Schulen im Zuge der Corona-Krise geschlossen haben, müssen alle Kinder zu Hause weiter gefördert werden. Sollten die Schließungen und Homeschooling längere Zeit andauern, dürften sich die bereits in den letzten Jahren zunehmenden Probleme bei der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland weiter verschärfen.
Schon vor der Corona-Krise mussten in Deutschland wieder Rückschritte bei der Bildungsgerechtigkeit verzeichnet werden. Die letzte PISA-Studie aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen den Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler und dem sozioökonomischen Hintergrund wieder zugenommen hat, nachdem es in den Jahren davor Fortschritte gab. Auch die PISA-Risikogruppe, also der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nur über sehr geringe Lesekompetenzen verfügen, ist wieder auf 20,7 Prozent im Jahr 2018 angestiegen. Jeder fünfte Neuntklässler weist demnach nur geringfügige Lesekompetenzen auf (Reiss et al., 2019).
Die Schulschließungen im Zuge der Corona-Krise dürften den Zusammenhang zwischen den Kompetenzen und dem sozioökonomischen Hintergrund der Kinder über folgende Wirkungskanäle noch verschärfen:
Keine Kompetenzförderung bei geschlossenen Kitas
Eigene Berechnungen auf der Basis des PISA-Datensatzes 2018 zeigen, dass der KITA-Besuch einen deutlich positiven Einfluss auf die PISA-Kompetenzen hat. Die frühkindliche Förderung nimmt oftmals eine kompensatorische Funktion ein, da nicht alle Kinder zu Hause in gleichem Umfang gefördert werden. Berechnungen auf der Basis des Sozio-ökonomischen Panels kommen zu dem Ergebnis, dass Mütter mit zunehmender Qualifikation ihren Kindern häufiger in deutscher Sprache Geschichten vorlesen oder erzählen (Anger/Geis, 2018). Zudem kann gezeigt werden, dass sich der Kita-Besuch positiv auf den Wortschatz der Kinder mit Migrationshintergrund auswirkt und den Förderbedarf in der deutschen Sprache verringert (Ruhose, 2013).
Eltern können unterschiedlich stark Schulbildung unterstützen
Doepke/Zilibotti (2019) zeigen eindrucksvoll, dass Eltern mit unterschiedlichen Bildungsressourcen in unterschiedlichem Zeitumfang und unterschiedlicher Qualität ihre Kinder fördern können. Diese „Erziehungslücke“ ist in den letzten Jahren in vielen Staaten gestiegen und eine zentrale Ursache für eine geringe Bildungsmobilität. Auch eigene Berechnungen mit den PISA-Daten zeigen, dass Eltern mit einem akademischen Hintergrund ihre Kinder öfter bei den Schulaufgaben unterstützen (Abbildung). Unabhängig davon, auf welcher PISA-Kompetenzstufe sich die Kinder befinden, erhalten Kinder von höher gebildeten Eltern mehr Unterstützung bei ihren Schulaufgaben. Gleichzeitig nimmt der Anteil der Kinder, die täglich Fernsehen oder Videos schauen, mit steigendem Bildungshintergrund der Mütter ab (Anger/Geis, 2018). Diese Unterschiede verlangen zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit mehr institutionelle Förderung durch qualitativ hochwertige Ganztagsschulen. Durch die Schließungen der Bildungseinrichtungen entfällt die Chance, gerade die Kinder aus bildungsfernen Haushalten intensiver zu fördern.

Digitale Kompetenzen unterscheiden sich
Um den neuen Schulstoff zu erlernen, könnten die Schülerinnen und Schüler ergänzend zum aktuell bestehenden begleiteten Basisunterricht über Arbeitszettel und Materialien auch auf digitale Angebote zurückgreifen wie digitale Lerntools, Erklärvideos etc. Doch hier besteht eine weitere Quelle der Bildungsungleichheit. Zum einem sind die einzelnen Haushalte unterschiedlich mit digitalen Geräten ausgestattet. Zum anderen unterscheiden sich die digitalen Kompetenzen der Jugendlichen wiederum stark nach dem sozioökonomischen Hintergrund. Die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Achtklässlern wurden in der International Computer and Information Literacy Study (I-CILS) erhoben. Dabei wird deutlich, dass Schülerinnen und Schüler, deren soziale Herkunft als höher einzuschätzen ist oder die keinen Migrationshintergrund aufweisen, höhere Kompetenzen aufweisen als Schülerinnen und Schüler mit einer niedrigeren sozialen Herkunft oder mit einem Migrationshintergrund (Eickelmann et al., 2019).
Sollte ein Start des normalen Unterrichts nach den Osterferien nicht möglich sein, sollten bundesweit Konzepte erarbeitet werden, um Rückstände, insbesondere bei Kindern aus bildungsfernen Haushalten, besser aufholen zu können. Für die Umsetzung sollten Chancen-Beauftragte in den Schulen ernannt und qualifiziert werden. Zudem sollte bei Wiederaufnahme des Unterrichts ein spezieller Förderunterricht angeboten werden.
Weitere Studien und Beiträge zum Thema Corona
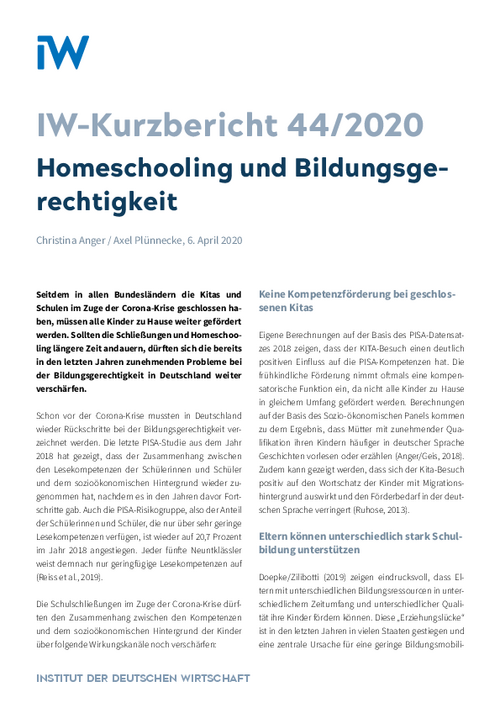
Christina Anger / Axel Plünnecke: Homeschooling und Bildungsgerechtigkeit
IW-Kurzbericht


Familien werden ungleich behandelt
IW-Ökonom Wido Geis-Thöne kritisiert in einem Gastbeitrag in der Fuldaer Zeitung den riesigen Flickenteppich bei den Kita-Gebühren. Die Betreuung des Nachwuchses könne je nach Region kostenlos sein, oder richtig ins Geld gehen.
IW
Elternbeiträge für die Kitabetreuung im regionalen Vergleich
Bei der Beteiligung der Eltern an den Kosten für die staatliche und staatlich geförderte Kindertagesbetreuung gehen die Länder sehr unterschiedliche Wege.
IW