Die Fachkräfteengpässe in Deutschland hemmen zunehmend das Wachstumspotenzial. Am deutschen Arbeitsmarkt fehlen derzeit etwa 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Wenn deutsche Unternehmen diesen Fachkräftebedarf decken könnten, würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 0,9 Prozent oder rund 30 Milliarden Euro höher ausfallen.
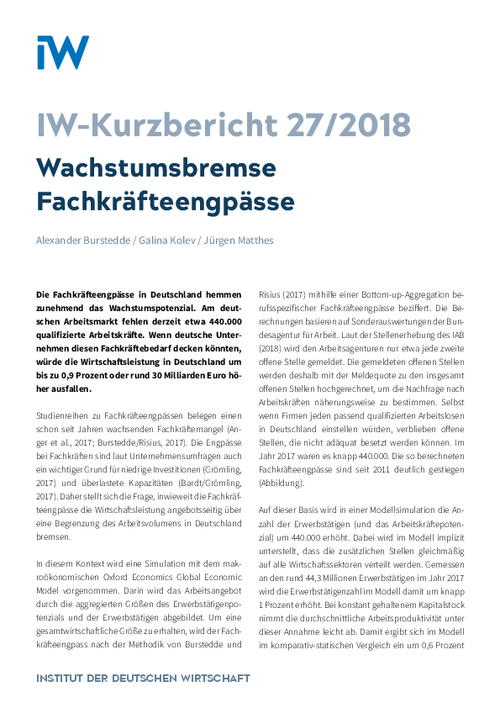
Wachstumsbremse Fachkräfteengpässe
IW-Kurzbericht

Die Fachkräfteengpässe in Deutschland hemmen zunehmend das Wachstumspotenzial. Am deutschen Arbeitsmarkt fehlen derzeit etwa 440.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Wenn deutsche Unternehmen diesen Fachkräftebedarf decken könnten, würde die Wirtschaftsleistung in Deutschland um bis zu 0,9 Prozent oder rund 30 Milliarden Euro höher ausfallen.
Studienreihen zu Fachkräfteengpässen belegen einen schon seit Jahren wachsenden Fachkräftemangel (Anger et al., 2017; Burstedde/Risius, 2017). Die Engpässe bei Fachkräften sind laut Unternehmensumfragen auch ein wichtiger Grund für niedrige Investitionen (Grömling, 2017) und überlastete Kapazitäten (Bardt/Grömling, 2017). Daher stellt sich die Frage, inwieweit die Fachkräfteengpässe die Wirtschaftsleistung angebotsseitig über eine Begrenzung des Arbeitsvolumens in Deutschland bremsen.
In diesem Kontext wird eine Simulation mit dem makroökonomischen Oxford Economics Global Economic Model vorgenommen. Darin wird das Arbeitsangebot durch die aggregierten Größen des Erwerbstätigenpotenzials und der Erwerbstätigen abgebildet. Um eine gesamtwirtschaftliche Größe zu erhalten, wird der Fachkräfteengpass nach der Methodik von Burstedde und Risius (2017) mithilfe einer Bottom-up-Aggregation berufsspezifischer Fachkräfteengpässe beziffert. Die Berechnungen basieren auf Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit. Laut der Stellenerhebung des IAB (2018) wird den Arbeitsagenturen nur etwa jede zweite offene Stelle gemeldet. Die gemeldeten offenen Stellen werden deshalb mit der Meldequote zu den insgesamt offenen Stellen hochgerechnet, um die Nachfrage nach Arbeitskräften näherungsweise zu bestimmen. Selbst wenn Firmen jeden passend qualifizierten Arbeitslosen in Deutschland einstellen würden, verblieben offene Stellen, die nicht adäquat besetzt werden können. Im Jahr 2017 waren es knapp 440.000. Die so berechneten Fachkräfteengpässe sind seit 2011 deutlich gestiegen (Abbildung).
Auf dieser Basis wird in einer Modellsimulation die Anzahl der Erwerbstätigen (und das Arbeitskräftepotenzial) um 440.000 erhöht. Dabei wird im Modell implizit unterstellt, dass die zusätzlichen Stellen gleichmäßig auf alle Wirtschaftssektoren verteilt werden. Gemessen an den rund 44,3 Millionen Erwerbstätigen im Jahr 2017 wird die Erwerbstätigenzahl im Modell damit um knapp 1 Prozent erhöht. Bei konstant gehaltenem Kapitalstock nimmt die durchschnittliche Arbeitsproduktivität unter dieser Annahme leicht ab. Damit ergibt sich im Modell im komparativ-statischen Vergleich ein um 0,6 Prozent höheres Produktionspotenzial. Da die Fachkräfteengpässe auch die Investitionstätigkeit bremsen (Grömling, 2017), ist die Annahme eines konstanten Kapitalstocks zu konservativ. Wenn mit der Anzahl der Erwerbstätigen auch der Kapitalstock proportional um 1 Prozent erhöht wird, weil die Unternehmen mehr investieren, würde das Produktionspotenzial mittelfristig um 0,9 Prozent höher ausfallen. Das entspricht knapp 30 Milliarden Euro (in Preisen von 2010).
Auch wenn die getroffene Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der zusätzlichen Stellen gewisse Einschränkungen mit sich bringt, kann diese Schätzung als Orientierung für die wachstumsbremsenden Effekte der aktuell vorliegenden Fachkräfteengpässe interpretiert werden. Der ermittelte Effekt auf die Wirtschaftsleistung dürfte eher unterschätzt werden, da fast die Hälfte der Fachkräfteengpässe auf das überproportional produktive produzierende Gewerbe entfällt, in dem nur gut 18 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten.
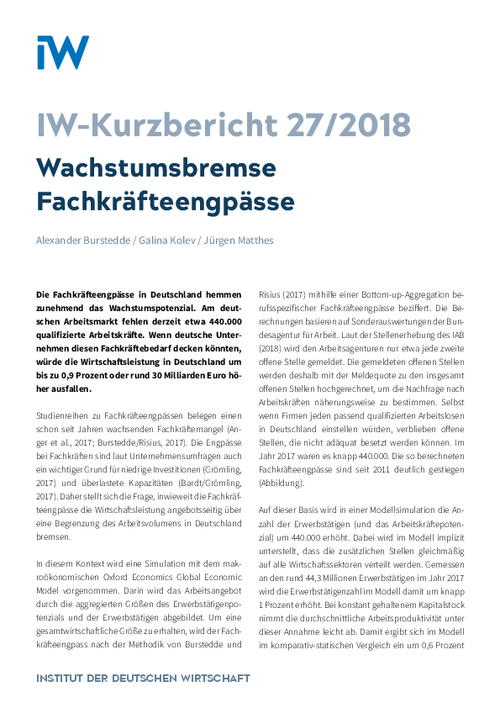
Alexander Burstedde / Galina Kolev / Jürgen Matthes: Wachstumsbremse Fachkräfteengpässe
IW-Kurzbericht


Inflation in der Eurozone: Der Weg bleibt holprig
Die Inflation in der Eurozone befindet sich auf dem Rückzug. Ein Aufatmen wäre aber verfrüht. Zweitrundeneffekte im Arbeitsmarkt sind im vollen Gange und setzen die Geldpolitik weiter unter Druck.
IW
Kabinett beschließt Wachstumspaket: „Kein großer Wurf, aber ein Zeichen”
Im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärt IW-Geschäftsführer Hubertus Bardt, er erwarte von der Bundesregierung weitere Schritte für mehr Wirtschaftswachstum. Im vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf würden zwar kleinere Dinge adressiert, insgesamt ...
IW