Die Frage einer effizienten und gerechten Ehegattenbesteuerung lässt sich aus steuersystematischer Sicht nicht allgemeingültig beantworten, sondern hängt in erster Linie von den zugrunde liegenden Annahmen und Normen ab.
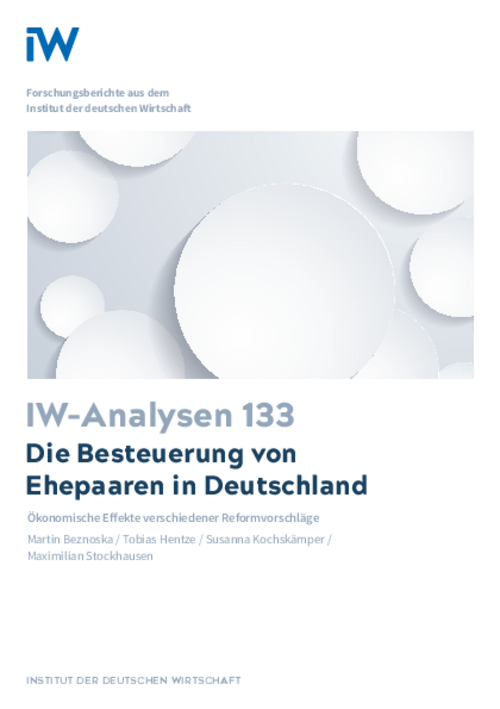
Die Besteuerung von Ehepaaren in Deutschland: Ökonomische Effekte verschiedener Reformvorschläge
IW-Analyse

Die Frage einer effizienten und gerechten Ehegattenbesteuerung lässt sich aus steuersystematischer Sicht nicht allgemeingültig beantworten, sondern hängt in erster Linie von den zugrunde liegenden Annahmen und Normen ab.
Dabei gilt es vor allem Fragen der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, das Ausmaß der Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft sowie (nach-)eheliche Unterhaltspflichten zu beachten. Auch wenn es keine klare Antwort auf die Frage nach der „richtigen“ Besteuerung von Ehepaaren gibt, ist auffällig, dass der Gesetzgeber widersprüchliche Regelungen im Steuer- und im Sozialrecht vorsieht. Das im Jahr 2008 geänderte Unterhaltsrecht legt nahe, dass Zweitverdiener in einer Ehe in eine Pfadabhängigkeit geraten können, wenn sie der Logik des Ehegattensplittings folgend während der Ehe nicht oder nur geringfügig erwerbstätig sind. Denn im Fall einer Scheidung erwartet der Gesetzgeber, dass sie wieder (voll) erwerbstätig werden, um sich selbst versorgen zu können. Die ökonomischen Auswirkungen verschiedener Reformmodelle lassen sich mittels Simulationsrechnungen bestimmen. Eine Beschränkung der derzeitigen Regelung beispielsweise durch ein Ehegattenrealsplitting oder eine Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag würde faktisch den Splittingeffekt begrenzen und daher vor allem Ehepaare schlechterstellen, in denen ein Partner nicht oder in Teilzeit arbeitet. Eine Einbeziehung von Kindern in das Splittingsystem – unabhängig vom Ehestatus der Eltern – würde grundsätzlich Haushalte besserstellen, in denen Kinder leben. Dieser Effekt würde mit der Höhe des Haushaltseinkommens zunehmen. Die Arbeitsanreize für Zweitverdiener in der Ehe, also vor allem Frauen, könnten durch die Umstellung auf alternative Besteuerungsformen ohne begleitende steuerliche Entlastung nur graduell gesteigert werden. Für durchgreifende Verbesserungen wären weitere Maßnahmen zum Beispiel beim Angebot an Kita-Plätzen, Minijobs und der kostenfreien Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung erforderlich.
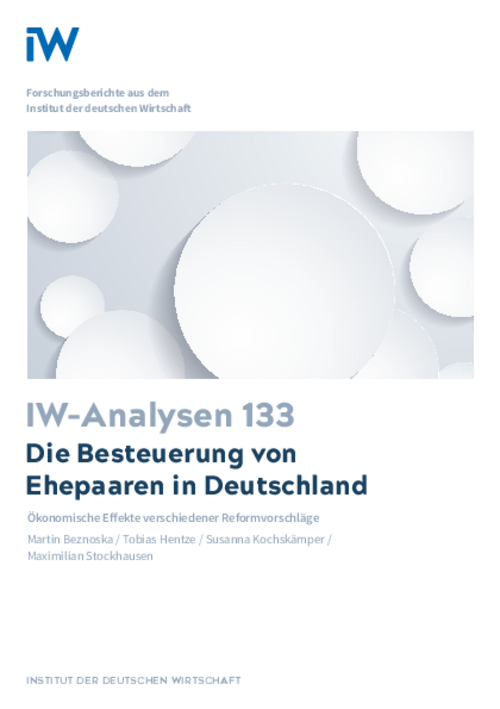
Martin Beznoska / Tobias Hentze / Susanna Kochskämper / Maximilian Stockhausen: Die Besteuerung von Ehepaaren in Deutschland – Ökonomische Effekte verschiedener Reformvorschläge
IW-Analyse


Stellungnahme für den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Landtags Schleswig-Holstein: Schuldenbremse und Investitionsquoten
Angesichts der bestehenden Herausforderungen, insbesondere der Transformation zur Klimaneutralität, erscheinen die bestehenden Grenzwerte der Schuldenbremse als zu eng. Dies gilt umso mehr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, in ...
IW
Schuldenbremse: Frische Impulse dank systematischer Steuerreformen
IW-Direktor Michael Hüther plädiert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für eine Ordnungspolitik, die endlich auf der Höhe der Zeit ist und neue Impulse für die Wirtschaft setzt. Sein Vorschlag: ein neuer Ausnahmetatbestand.
IW