Die EU-Kommission legt heute einen Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz vor. Dabei will sie im Vergleich zu Deutschland mehr Unternehmen in die Pflicht nehmen, höhere Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Lieferketten sicherzustellen. Dies führt zwar zu mehr Transparenz, aber auch zu mehr Bürokratie und höheren Kosten, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.

EU-Lieferkettengesetz: Jedes fünfte Unternehmen will Preise erhöhen
Noch bevor das deutsche Lieferkettengesetz 2023 in Kraft tritt, macht die EU Druck: Sie will per Gesetz Unternehmen verpflichten, stärker auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu achten. Betroffen sind Berichten zufolge Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und einem weltweiten Nettoumsatz von mindestens 150 Millionen Euro. Welche Auswirkungen Unternehmen erwarten, zeigt eine aktuelle IW-Studie: So wollen 18 Prozent der vor Kurzem vom IW befragten Unternehmen nur noch Vorprodukte aus Ländern beziehen, die ausreichend auf die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltschutzstandards achten. Etwa zwölf Prozent der Unternehmen planen, sich aus Ländern mit schwachen Governance-Strukturen zurückzuziehen – davon wären vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer betroffen.
Höhere Standards und mehr Bürokratie
Das neue Gesetz sorgt außerdem für zusätzliche Bürokratie: Acht Prozent der Unternehmen wollen für das entsprechende Monitoring externe Dienstleister beauftragen. Um die zusätzlichen Kosten zu finanzieren, beabsichtigt jedes fünfte Unternehmen, die Preise für seine Produkte zu erhöhen und damit an Kunden zu überwälzen.
Nachteile für Entwicklungs- und Schwellenländer
Zwar zielt das Gesetz auf eine Verbesserung der Menschenrechte und Umweltstandards in Drittländern ab, doch es bringt auch unerwünschte Nebenwirkungen. Die Einführung einer Lieferkettenkontrolle ist teuer. Ziehen sich Unternehmen aufgrund der hohen Kosten aus Schwellen- und Entwicklungsländern mit schwacher Gesetzeskontrolle zurück, hätte dies verheerende Folgen für die dort von ihnen geschaffenen Arbeitsplätze, die etablierten Produktionsstandards sowie das bereits investierte Kapital. „Die neue EU-Regelung muss daher sorgfältig abgewogen werden“, sagt IW-Ökonomin Galina Kolev. „Sie sollte nur auf Unternehmen abzielen, bei denen Beweise für den Missbrauch schwacher Produktionsstandards in Drittländern vorliegen.“ So kann die neue Regelung wirksam umgesetzt werden, ohne dass es zu unerwünschten Nebeneffekten durch steigende Bürokratiekosten und zunehmende Unsicherheit kommt.
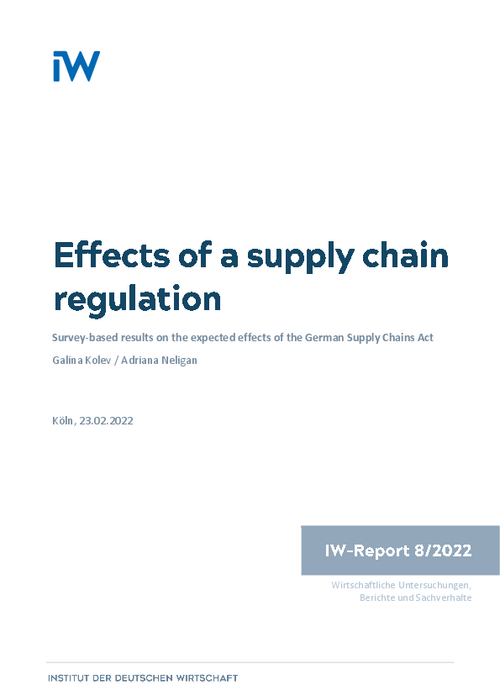
Effects of a supply chain regulation: Survey-based results on the expected effects of the German Supply Chains Act


Inflation in der Eurozone: Der Weg bleibt holprig
Die Inflation in der Eurozone befindet sich auf dem Rückzug. Ein Aufatmen wäre aber verfrüht. Zweitrundeneffekte im Arbeitsmarkt sind im vollen Gange und setzen die Geldpolitik weiter unter Druck.
IW
Trump oder Harris oder …? Worauf sich Europa einstellen muss
Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Donald Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl. Auf Seiten der Demokraten hat der amtierende Präsident seine Kandidatur nach langem Zögern zurückgezogen, Vizepräsidentin Kamala Harris wird mit hoher ...
IW