In den vergangenen Jahren zeigt sich beim Bundeshaushalt stets das gleiche Bild: Die tatsächlichen Zinsausgaben fielen geringer aus als geplant, die Steuereinnahmen stiegen stärker als von der Bundesregierung angenommen. Beide Entwicklungen verschafften dem Bund neue Handlungsspielräume.
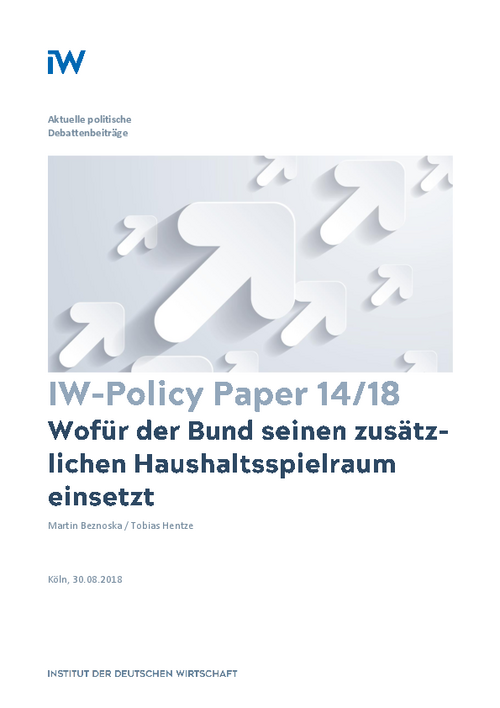
Bundeshaushalt: Evolution der Ausgaben des Bundes im ökonomisch günstigen Umfeld
IW-Policy Paper

In den vergangenen Jahren zeigt sich beim Bundeshaushalt stets das gleiche Bild: Die tatsächlichen Zinsausgaben fielen geringer aus als geplant, die Steuereinnahmen stiegen stärker als von der Bundesregierung angenommen. Beide Entwicklungen verschafften dem Bund neue Handlungsspielräume.
In den Jahren 2013 bis 2018 summiert sich dieser auf rund 82 Milliarden Euro, wovon zwei Drittel den geringer ausgefallenen Zinsausgaben und ein Drittel den höheren Steuereinnahmen zuzurechnen sind. Hinzu kommen in diesem Zeitraum höhere sonstige Einnahmen, wie zum Beispiel Gebühren, in Höhe von kumuliert 9 Milliarden Euro.
Zum einen nutzte die Bundesregierung den zusätzlichen Spielraum für neue laufende Ausgaben, zum anderen baute sie eine Rücklage auf. Im Zeitraum von 2013 bis 2018 fielen die Ausgaben (ohne Zinsen) um insgesamt 67 Milliarden Euro höher aus als die Finanzplanung es vorsah – als Vergleich dient dabei stets der Mittelwert der zwei, drei und vier Jahre vor dem Ist-Jahr erschienenen Finanzpläne des Bundes. Die Rücklage beläuft sich auf mittlerweile 24 Milliarden Euro. Allerdings soll diese nicht ihrer eigentlichen Funktion als Risikopuffer gerecht werden, vielmehr will die Bundesregierung damit Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag finanzieren. Damit handelt es sich letztlich auch um eine Ausgabensteigerung. Auf alternative Verwendungsmöglichkeiten dieses unverhofften Haushaltsspielraums – Steuerentlastung oder Schuldentilgung – verzichtet die Bundesregierung. Die Steuerquote des Bundes ist jüngst sogar gestiegen.
Mit Blick auf die einzelnen Aufgabenbereiche zeigt sich, dass vor allem die Ausgaben für Verteidigung, Arbeitsmarkt, Verkehrsinfrastruktur und – in jüngerer Vergangenheit zunehmend – innere Sicherheit und Entwicklungshilfe gesteigert werden. Für Forschung und Bildung werden die zusätzlichen Ausgaben dagegen kaum verwendet. Bei einer Unterscheidung nach Ausgabearten zeigt sich, dass in absoluten Werten beispielsweise der Personalaufwand stärker an dem Spielraum partizipiert hat als die Sachinvestitionen – relativ betrachtet ist es umgekehrt. Im Vergleich zu 2013 ist im Haushalt 2018 für das Ressort Arbeit und Soziales ein größerer Anteil vorgesehen, während der Prozentsatz für Verkehr und digitale Infrastruktur sinkt.
Mit einer Politik des Geldausgebens nutzt die Bundesregierung die außerordentlich günstigen Rahmenbedingungen nicht im Sinne einer langfristig soliden Haushaltspolitik. Ein Ende des Aufschwungs oder eine Normalisierung des Zinsniveaus würden den Bundeshaushalt schnell wieder in rote Zahlen führen. Da die zusätzlichen Ausgaben überwiegend nicht in Zukunftsinvestitionen fließen, wird eine Wachstumsrendite eher gering ausfallen. Eine Rückzahlung von Schulden oder eine gezielte Entlastung von Bürgern und Unternehmen bleibt auf der Strecke. Dabei wäre ein ausgewogener Mix aus Schuldentilgung, Steuerentlastung und einem wachstumsfördernden Ausgabenplus die bessere Verwendung des zusätzlichen Spielraums.
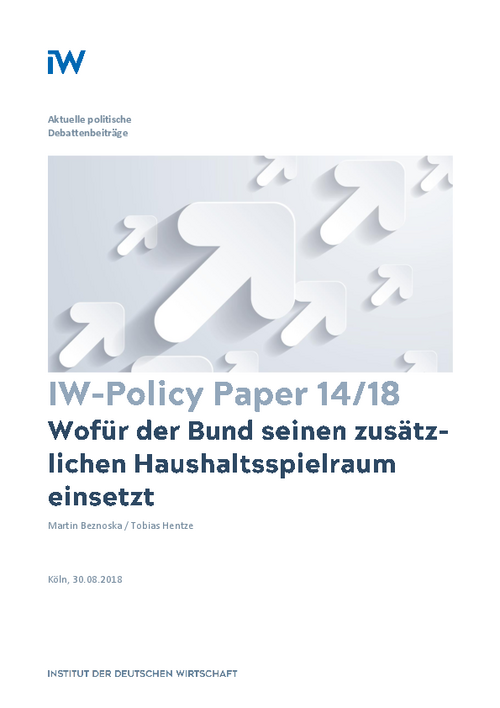
Evolution der Ausgaben des Bundes im ökonomisch günstigen Umfeld
IW-Policy Paper


Bundeshaushalt 2025: Getrickst, verschleppt und teuer erkauft
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute den Haushaltsplan für das kommende Jahr im Bundestag vorgestellt. Das Ergebnis ist unausgeglichen: Probleme werden in die Zukunft verlagert und Investitionen bleiben auf der Strecke.
IW
Haushaltseinigung: Kein Problem wirklich gelöst
Nach langem Streit hat die Bundesregierung sich heute auf einen Haushaltsrahmen für 2025 geeinigt – und vor lauter Streit die eigentlichen Herausforderungen übersehen, schreibt IW-Direktor Michael Hüther in einem Gastbeitrag für ZEIT online.
IW