Im Vorfeld der Bundestagswahl wird unter anderem eine Rückkehr zur vollständig paritätischen Beitragsfinanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung gefordert. Allerdings entpuppt sich die damit verbundene Hoffnung auf eine nachhaltige Entlastung der Beitragszahler als Irrweg.
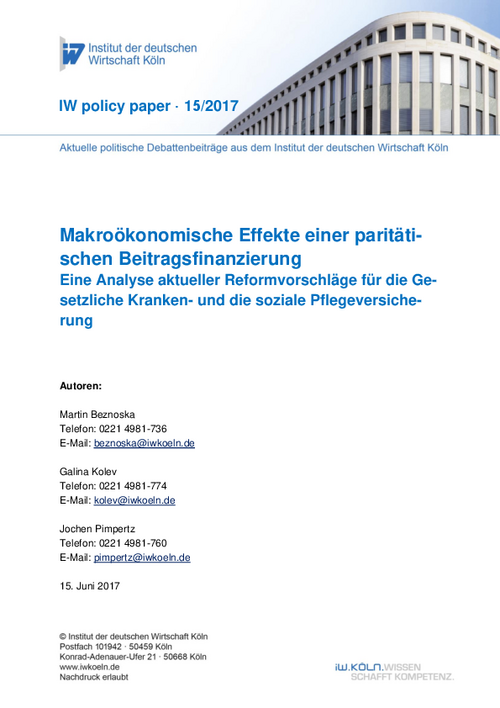
Makroökonomische Effekte einer paritätischen Beitragsfinanzierung: Eine Analyse aktueller Reformvorschläge für die Gesetzliche Kranken- und die soziale Pflegeversicherung

Im Vorfeld der Bundestagswahl wird unter anderem eine Rückkehr zur vollständig paritätischen Beitragsfinanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung gefordert. Allerdings entpuppt sich die damit verbundene Hoffnung auf eine nachhaltige Entlastung der Beitragszahler als Irrweg.
Der bislang allein von den Mitgliedern zu zahlende Zusatzbeitrag würde damit abgeschafft und je zur Hälfte auf den bisherigen Beitragssatzanteil der Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeschlagen. Letztlich müssen die Arbeitnehmer sämtliche Arbeitskosten, also auch die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, mit ihrer Leistung erwirtschaften, damit ihre Beschäftigung nachhaltig gesichert ist.
Die hälftige Teilung des bisherigen Zusatzbeitrags belastet die Arbeitgeber in der ersten Runde um 6 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. Für die Ruheständler muss die Gesetzliche Rentenversicherung einen um 1,4 Milliarden Euro höheren Beitragszuschuss zahlen. Im Gegenzug werden die privaten Haushalte der Arbeitnehmer und Rentenbezieher um 7,4 Milliarden Euro entlastet. Dennoch eignet sich die Maßnahme nicht als sozialpolitisches Instrument. Denn die Verteilung der Nettoeinkommen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lässt sich damit kaum verändern. Sowohl der Gini-Koeffizient als auch die Relation der Nettoeinkommen zwischen oberem und unterem Zehntel (90/10-Verhältnis) sinken lediglich um 0,2 Prozent. Dafür drohen aber Anpassungsreaktionen, die die Gesellschaft teuer zu stehen kämen. Denn die Unternehmen werden versuchen, die höheren Arbeitskosten bereits kurzfristig über steigende Güterpreise auszugleichen. Damit verschlechtert sich aber deren Wettbewerbsfähigkeit. In der Folge wachsen die Exporte langsamer und mittelbar leidet auch die Beschäftigung. Eine Simulation mithilfe des Global Economic Model von Oxford Economics zeigt, dass zehn Jahre nach der Abschaffung des Zusatzbeitrags das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent niedriger ausfallen würde als unter dem heutigen Beitragsrecht – in Preisen des Jahres 2010 gerechnet minus 13 Milliarden Euro. Die Erwerbslosenquote läge um 0,8 Prozentpunkte über dem Szenario ohne Reform.
Selbst in Kombination mit einer höheren Beitragsbemessungsgrenze bleiben die Verteilungseffekte gering. Der Gini-Koeffizient sinkt dann zwar in der ersten Runde um knapp 1 Prozent, das 90/10-Verhältnis sogar um 2 Prozent. Doch die makroökonomischen Effekte wiegen ungleich schwerer. Unter der vereinfachenden Annahme, dass sich die höhere Arbeitskosten infolge der erweiterten Beitragspflicht gleichmäßig auf alle Arbeitnehmer verteilen, würde das Bruttoinlandsprodukt nach zehn Jahren um 0,9 Prozent niedriger ausfallen als unter dem derzeitigen Beitragsrecht – in Preisen des Jahres 2010 gerechnet minus 29 Milliarden Euro. Die Erwerbslosenquote läge sogar um 1,8 Prozentpunkte höher.
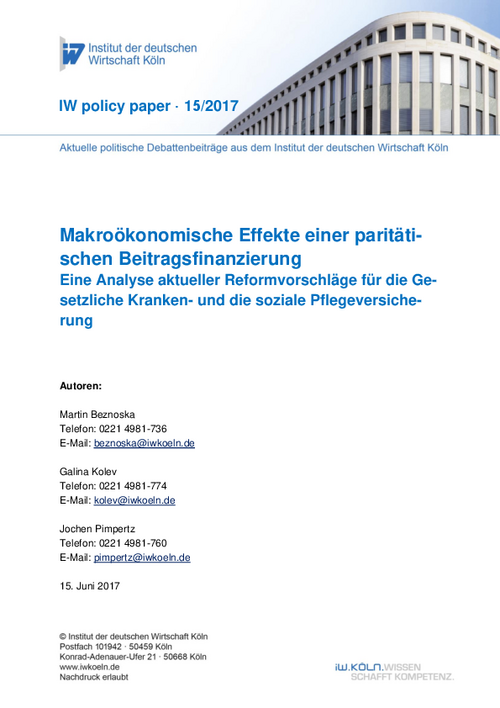
Makroökonomische Effekte einer paritätischen Beitragsfinanzierung: Eine Analyse aktueller Reformvorschläge für die Gesetzliche Kranken- und die soziale Pflegeversicherung


Rentenpolitik für oder mit alternden Mehrheiten?
Die Bevölkerung altert und die Versorgungsinteressen der betagten Bürger rücken damit zunehmend in den Mittelpunkt der Politik.
IW
Politische Ökonomie der Rentenreform
Die Alterung der deutschen Bevölkerung führt in der umlagefinanzierten Gesetzlichen Rentenversicherung zu höheren Beiträgen bei sinkendem Sicherungsniveau. Dies ließe sich bremsen, wenn mit steigender Regelaltersgrenze der Renteneintritt später erfolgte.
IW