Die Metall- und Elektrowirtschaft ist unangefochtener Spitzenreiter bei Innovationen. Deutschlandweit melden M+E-Unternehmen aktuell 75 Prozent aller Patente an – bei einem Erwerbstätigenanteil von 12 Prozent. Der M+E-Anteil an allen unternehmerischen Patentanmeldungen liegt bei rund 84 Prozent, in den hochinnovativen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern sogar bei über 90 Prozent.
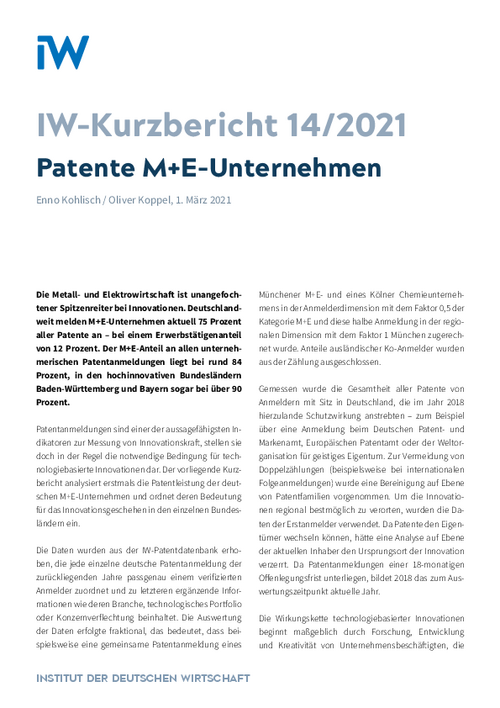
Patente M+E-Unternehmen

Die Metall- und Elektrowirtschaft ist unangefochtener Spitzenreiter bei Innovationen. Deutschlandweit melden M+E-Unternehmen aktuell 75 Prozent aller Patente an – bei einem Erwerbstätigenanteil von 12 Prozent. Der M+E-Anteil an allen unternehmerischen Patentanmeldungen liegt bei rund 84 Prozent, in den hochinnovativen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern sogar bei über 90 Prozent.
Patentanmeldungen sind einer der aussagefähigsten Indikatoren zur Messung von Innovationskraft, stellen sie doch in der Regel die notwendige Bedingung für technologiebasierte Innovationen dar. Der vorliegende Kurzbericht analysiert erstmals die Patentleistung der deutschen M+E-Unternehmen und ordnet deren Bedeutung für das Innovationsgeschehen in den einzelnen Bundesländern ein.
Die Daten wurden aus der IW-Patentdatenbank erhoben, die jede einzelne deutsche Patentanmeldung der zurückliegenden Jahre passgenau einem verifizierten Anmelder zuordnet und zu letzteren ergänzende Informationen wie deren Branche, technologisches Portfolio oder Konzernverflechtung beinhaltet. Die Auswertung der Daten erfolgte fraktional, das bedeutet, dass beispielsweise eine gemeinsame Patentanmeldung eines Münchener M+E- und eines Kölner Chemieunternehmens in der Anmelderdimension mit dem Faktor 0,5 der Kategorie M+E und diese halbe Anmeldung in der regionalen Dimension mit dem Faktor 1 München zugerechnet wurde. Anteile ausländischer Ko-Anmelder wurden aus der Zählung ausgeschlossen.
Gemessen wurde die Gesamtheit aller Patente von Anmeldern mit Sitz in Deutschland, die im Jahr 2018 hierzulande Schutzwirkung anstrebten – zum Beispiel über eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, Europäischen Patentamt oder der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Zur Vermeidung von Doppelzählungen (beispielsweise bei internationalen Folgeanmeldungen) wurde eine Bereinigung auf Ebene von Patentfamilien vorgenommen. Um die Innovationen regional bestmöglich zu verorten, wurden die Daten der Erstanmelder verwendet. Da Patente den Eigentümer wechseln können, hätte eine Analyse auf Ebene der aktuellen Inhaber den Ursprungsort der Innovation verzerrt. Da Patentanmeldungen einer 18-monatigen Offenlegungsfrist unterliegen, bildet 2018 das zum Auswertungszeitpunkt aktuelle Jahr.

<div id="highcharts-RHxGUgHKJ"><script src="https://app.everviz.com/inject/RHxGUgHKJ/" defer="defer"></script></div>
Die Wirkungskette technologiebasierter Innovationen beginnt maßgeblich durch Forschung, Entwicklung und Kreativität von Unternehmensbeschäftigten, die für die Patentanmeldungen als Erfinder verantwortlich zeichnen. Die Beschäftigten treten die Nutzungsrechte an den Patenten im Rahmen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes an ihre Arbeitgeber ab, sodass letztere als Patentanmelder und damit auch als Inhaber fungierenden. Für das Jahr 2018 verzeichneten die Metall- und Elektrobranchen einen Anteil von 12,2 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Erwerbstätigen (Mikrozensus, o. J.). Neben der Quantität ist jedoch insbesondere die Qualifikation der Beschäftigten entscheidend. Die M+E-Erwerbstätigen verfügen deutlich häufiger über einen qualifizierenden Berufs- oder Studienabschluss in einer mathematisch-technisch-naturwissenschaftlichen Fachrichtung (MINT) – und es sind allen voran diese MINT-Akademiker, die für die Innovationskraft einer Branche verantwortlich zeichnen (Anger et al., 2020, 18). Für das Jahr 2018 vereinten die Metall- und Elektrobranchen 25,0 Prozent der gesamtwirtschaftlichen MINT-Erwerbstätigen auf sich. Ergänzend zu der innovationsaffinen Erwerbstätigenstruktur investieren die M+E-Unternehmen auf der Input-Seite neben dem Personal auch weit überdurchschnittlich in die entsprechende Innovationsinfrastruktur in Form von Forschungslaboren und -materialien. Konkret wurden 57,6 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Innovationsaufwendungen des Jahres 2018 von den M+E-Branchen erbracht (ZEW, 2020). Auf der Output-Seite des Innovationsgeschehens schlägt sich all dies in 74,8 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Patentanmeldungen nieder. Für einen adäquaten Vergleich der Patentaktivität der M+E-Unternehmen müssen aus diesem Wert noch die Patentanmeldungen freier Erfinder („Garagentüftler“) sowie nicht gewinnerzielungsorientierter juristischer Personen wie Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Vereine, gemeinnützige GmbHs etc., herausgerechnet werden. Die in der Abbildung für das Jahr 2018 ausgewiesenen Ergebnisse zeigen eine überragende Bedeutung der M+E-Unternehmen für die Innovationskraft Deutschlands. Bundesweit stammen aktuell 83,5 Prozent aller unternehmerischen Patentanmeldungen von M+E-Unternehmen, in den als besonders innovationsstark bekannten Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern sogar über 90 Prozent. Ebenfalls stark von M+E-Unternehmen geprägt ist die Innovationskraft der thüringischen Wirtschaft, deren Ergebnisse durch die Innovationshochburg Jena mit ihrer global erfolgreichen optoelektronischen Industrie getragen werden. Der unterdurchschnittliche M+E-Anteil in Rheinland-Pfalz lässt sich durch die dortige Dominanz der multinational agierenden chemischen Industrie erklären. Beispielsweise beträgt der M+E-Anteil an den unternehmerischen Patenten in Ludwigshafen gerade einmal 3,4 Prozent. Am anderen Ende der Skala erreicht mit Salzgitter eine Hochburg der Stahlindustrie eine Quote von 100 Prozent M+E-Patentanmeldungen.
Die besondere Innovationsstärke der Kfz-Industrie wurde bereits ausführlich dokumentiert (Koppel et al., 2019). Und auch in der vorliegenden Auswertung zeigt sich, dass innerhalb der M+E-Branche die Kfz-Industrie für eine besonders hohe Patentleistung verantwortlich zeichnet, sodass Automobilhochburgen besonders stark die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer prägen. Beispielsweise zeichnet die Automobilindustrie in Wolfsburg für 99,8 aller M+E-Patentanmeldungen verantwortlich und in der Folge auch für 99,5 Prozent aller anmelderübergreifenden Anmeldungen.
Unter dem Strich trägt die Metall- und Elektrowirtschaft zu mehr als vier Fünftel zur unternehmerischen Patentaktivität in Deutschland bei, in 14 von 16 Bundesländern mindestens zur Hälfte. Damit bleibt sie in Deutschland unangefochtener Spitzenreiter und das nationale Zugpferd bei Innovationen.
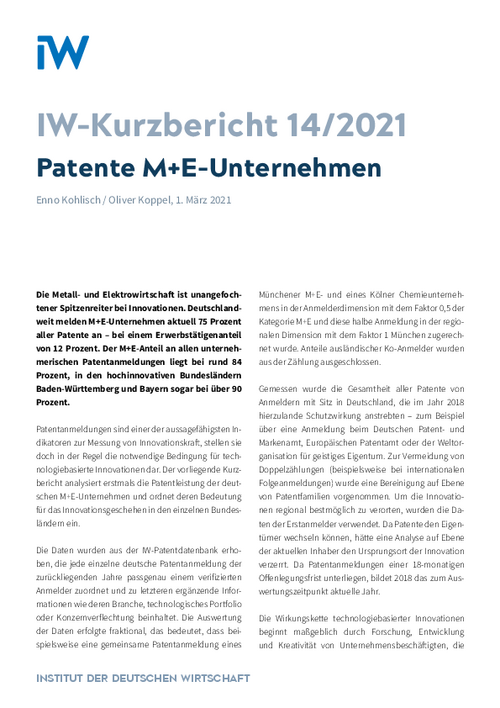
Patente M+E-Unternehmen


IMP-Index: Eisenerzschwäche kaschiert festen Markt
Das Preisniveau für die wichtigsten Industriemetalle verzeichnete im März einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr, schreibt IW-Geschäftsführer Hubertus Bardt in einem Gastbeitrag für die Börsen-Zeitung.
IW
Verteidigungsausgaben: Gerade so genug für die NATO?
Zwei Jahre nach Ausrufen der „Zeitenwende“ durch Bundeskanzler Olaf Scholz meldet die Bundesregierung für 2024 das Einhalten des Zwei-Prozent-Ziels an die NATO. Das heißt, erstmals seit gut 30 Jahren gibt Deutschland im laufenden Jahr demnach jeden fünfzigsten ...
IW