Was der einzelne Arbeitnehmer verdient, hängt von vielen Faktoren wie der Arbeitsleistung selbst oder der Verfügbarkeit derselben ab. Ein Lohn, der ökonomisch betrachtet angemessen ist, muss nicht unbedingt als gerecht oder fair empfunden werden.
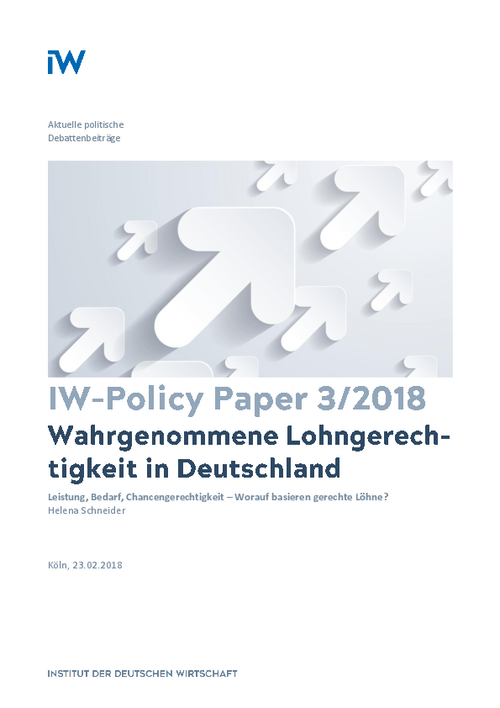
Wahrgenommene Lohngerechtigkeit in Deutschland
IW-policy paper

Was der einzelne Arbeitnehmer verdient, hängt von vielen Faktoren wie der Arbeitsleistung selbst oder der Verfügbarkeit derselben ab. Ein Lohn, der ökonomisch betrachtet angemessen ist, muss nicht unbedingt als gerecht oder fair empfunden werden.
Da Lohnungleichheiten jedoch am besten zu rechtfertigen sind, wenn sie von den Beschäftigten als gerecht angesehen werden, kommt der Wahrnehmung von Lohngerechtigkeit große Bedeutung zu. Daher wird in der vorliegenden Analyse anhand von Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) aus dem Jahr 2015 untersucht, wie die Beschäftigten in Deutschland ihr Brutto- und Nettoerwerbseinkommen bewerten. In der deskriptiven Analyse zeigt sich, dass sich eine Mehrheit der Beschäftigten gerecht entlohnt fühlt, der Nettoverdienst jedoch über alle Lohngruppen hinweg als ungerechter empfunden wird als der Bruttoverdienst.
Auch in einer auf Logit-Schätzungen beruhenden multivariaten Betrachtung wird deutlich, dass die Zahlung von Steuern und Sozialabgaben einen negativen Einfluss auf das Gerechtigkeitsempfinden ausübt. Die Aussicht auf Transferzahlungen kann den negativen Effekt der Zahlung von Abgaben selbst bei Niedrigverdienern nicht abschwächen, sondern wirkt sich sogar zusätzlich negativ auf das Gerechtigkeitsempfinden aus. Neben den beschriebenen Umverteilungsmechanismen haben Leistungskomponenten wie die Berufserfahrung oder der Erwerbsstatus über alle Lohnklassen hinweg einen entscheidenden Einfluss auf die empfundene Lohngerechtigkeit. Bedarfskomponenten – wie die Anzahl der Kinder oder der Familienstand – fallen weniger ins Gewicht. Eine hohe Bedeutung kommt zudem der empfundenen Chancengerechtigkeit zu. Schätzt ein Beschäftigter die Chancen auf Bildung und Zugangsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt als gerecht verteilt an, ist die Wahrscheinlichkeit für eine empfundene Lohngerechtigkeit deutlich erhöht. Auch eine Tarifbindung wirkt sich positiv auf die individuelle Gerechtigkeitsbewertung des Erwerbseinkommens aus.
Um das Gerechtigkeitsempfinden der Beschäftigten in Deutschland zu erhöhen, sollte somit insbesondere die wahrgenommene Chancengerechtigkeit weiter verbessert werden. Umfassende Implikationen für Umverteilungsmechanismen abzuleiten, fällt hingegen schwer. Denn so ist staatliche Umverteilung immer auch mit einer Einschränkung der von den Beschäftigten als so wichtig empfundenen Leistungsprinzipien und somit negativen Effekten auf die wahrgenommene Lohngerechtigkeit verbunden. Dennoch erscheint eine Entlastung der Einkommen mit mittlerer Abgabenlast auf Grundlage der vorliegenden Analyse als wünschenswert, da in dieser Gruppe ein vergleichsweise hohes Ungerechtigkeitsempfinden herrscht.
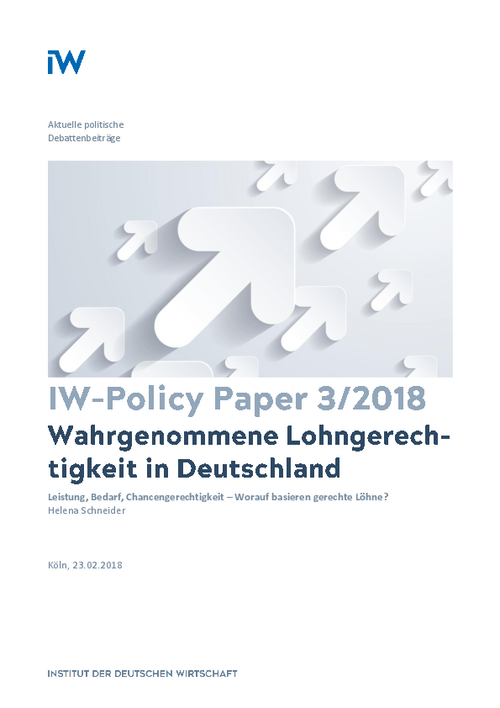
Helena Schneider: Wahrgenommene Lohngerechtigkeit in Deutschland
IW-policy paper


Tarifverhandlungen 2024: Es droht eine höhere Inflation
Im Frühjahr stehen weitere Tarifverhandlungen in der Chemie- und Baubranche sowie dem Bankwesen an. Beharren die Gewerkschaften auf ihre hohen Forderungen, könnte dies auch die Inflation wieder hochtreiben. Davor warnt eine neue Studie des Instituts der ...
IW
Die deutsche Lohnpolitik zwischen Inflation und Stagnation: Drohen Zielkonflikte mit der Geldpolitik?
Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise setzte ein Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt ein, der Spielraum für eine vergleichsweise expansive Lohnpolitik eröffnete.
IW