Der deutsche Arbeitsmarkt wird von den Folgen der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen. Damit drohen auch negative Folgewirkungen, etwa bei wichtigen Verteilungsindikatoren. Insbesondere wegen des starken Einsatzes von Kurzarbeit fällt der Anstieg der registrierten Arbeitslosigkeit aber gemessen am Nachfrage- und Produktionseinbruch bisher vergleichsweise gering aus.
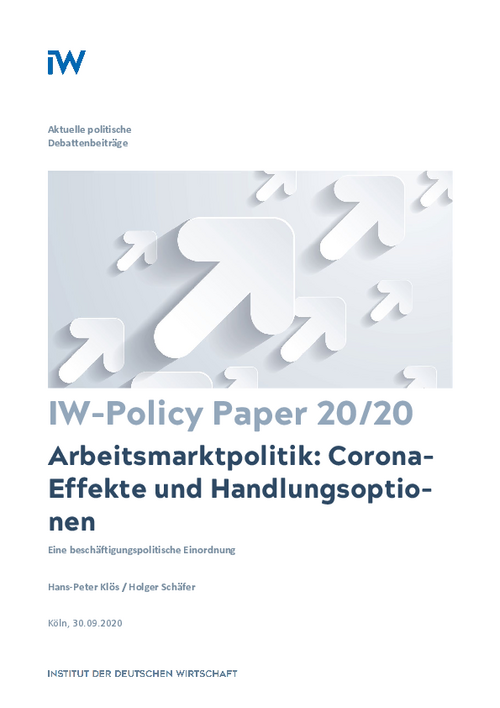
Arbeitsmarktpolitik: Corona-Effekte und Handlungsoptionen: Eine beschäftigungspolitische Einordnung
IW-Policy Paper

Der deutsche Arbeitsmarkt wird von den Folgen der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen. Damit drohen auch negative Folgewirkungen, etwa bei wichtigen Verteilungsindikatoren. Insbesondere wegen des starken Einsatzes von Kurzarbeit fällt der Anstieg der registrierten Arbeitslosigkeit aber gemessen am Nachfrage- und Produktionseinbruch bisher vergleichsweise gering aus.
Dazu hat auch ein bisher nicht dagewesener koordinierter Instrumenteneinsatz der Finanzpolitik, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik beigetragen, mit dem breite Schutzschirme sowohl für Unternehmen wie auch für Beschäftigte aufgespannt worden sind. Diese haben sowohl auf der Arbeitsnachfrage als auch auf der Arbeitsangebotsseite des Arbeitsmarktes angesetzt und die Beschäftigung deutlich stabilisiert. Eine erste Evaluation der Zielgenauigkeit der umfangreichen konjunktur- und arbeitsmarktstabilisierenden Maßnahmen neben dem Kurzarbeitergeld sind dies z.B. Sofort- und Überbrückungshilfen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aber auch der erleichterte Zugang zur Grundsicherung für Selbständige steht aber noch aus.
Wegen der finanziellen Dimensionen des Mitteleinsatzes lassen sich die ergriffenen Maßnahmen aber nicht unbegrenzt weiterführen. Jenseits der aktuellen Konjunkturstabilisierung gibt es daher zunehmend eine Debatte über strukturell wirkende Maßnahmen zur weiteren Stabilisierung des Arbeitsmarktes nach der Krise. Hier stehen sich im Kern zwei grundsätzliche Denkschulen gegenüber: Ein zentraler politischer Debattenstrang thematisiert die Wiederbelebung von Arbeitszeitverkürzungs- und Grundeinkommenskonzepten, ergänzt um weitergehende Rechtsansprüche für Beschäftigte, etwa im Bereich Home-Office und bei Weiterbildung und Qualifizierung. Ein anderer Debattenstrang zielt auf die Förderung flexibler Beschäftigungsformen und die Senkung der Einstellungsbarrieren für Unternehmen, etwa im Arbeitszeit-, Befristungs- und Selbständigkeitsrecht.
Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung wird kritisch bewertet, weil sie zu einer sinkenden Stundenproduktivität und steigenden Lohnstückkosten führt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wirkt sich negativ auf das Arbeitsangebot aus und ist nicht finanzierbar. Ein Recht auf Homeoffice griffe in das Dispositionsrecht von Unternehmen ein. Die Regelungen zum Home-Office gehören vielmehr eindeutig auf die betriebliche Ebene. Hingegen kann eine verstärkte Weiterbildung positiv wirken. Mit Blick auf eine durch das Qualifizierungschancengesetz ohnehin verbreiterte Förderkulisse besteht aber neben einer fraglichen Effektivität die Gefahr von verstärkten Mitnahmeeffekten. Dies würde bei einem Recht auf Weiterbildung noch in besonderer Weise gelten. Zu prüfen sind demgegenüber eine temporäre Änderung des Befristungsrechts bei Neueinstellungen durch eine Aussetzung des Vorbeschäftigungsverbots, die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der wöchentlichen Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten sowie die Erleichterung flexibler Beschäftigung, etwa durch eine Aussetzung der Höchstüberlassungsdauer in der Zeitarbeit und ein verändertes Statusfeststellungsverfahren bei der Abgrenzung abhängiger von selbständiger Beschäftigung. Für Existenzgründer ist wichtig, dass das bewährte Instrumentarium von Werk- und Dienstverträgen weiterhin werden kann. Auch der Einsatz von IT-Freelancern in Unterneh-men sollte erleichtert werden.
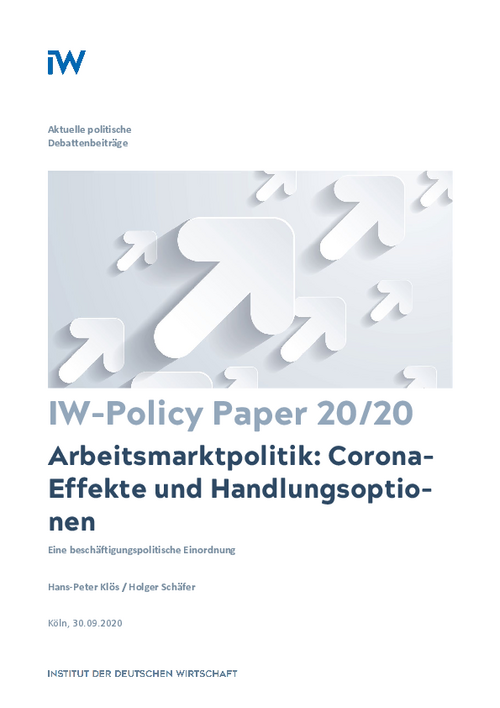
Hans-Peter Klös / Holger Schäfer: Arbeitsmarktpolitik – Corona-Effekte und Handlungsoptionen, Eine beschäftigungspolitische Einordnung
IW-Policy Paper


Arbeitsmarkt 2024: Die Rückkehr der Arbeitslosigkeit?
Während sich der Arbeitsmarkt in Deutschland im vergangenen Jahr trotz Rezession als erstaunlich stabil erwies, werden sich im laufenden Jahr zunehmend die Folgen der konjunkturellen Schwäche zeigen. Die Arbeitslosigkeit steigt auf den höchsten Stand seit ...
IW
Betriebliche Gesundheitsförderung – resilient in Krisenzeiten
Hohe Krankenstände rücken die Gesundheitsförderung wieder verstärkt in den betrieblichen Fokus. Daten des IW-Personalpanels zeigen die Vielfalt und Verbreitung des betrieblichen Angebots. Auch die individuelle Resilienz wird vielerorts gestärkt – rund jedes ...
IW