In dieser Studie wird eine Methodik beschrieben, mit der die Entwicklung von Beschäftigung und Fachkräftemangel fünf Jahre in die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Dabei wird angenommen, dass sich die empirisch feststellbaren Trends der jüngeren Vergangenheit unverändert fortsetzen. Die Berechnung von Alternativszenarien mit veränderten Trends ist möglich.
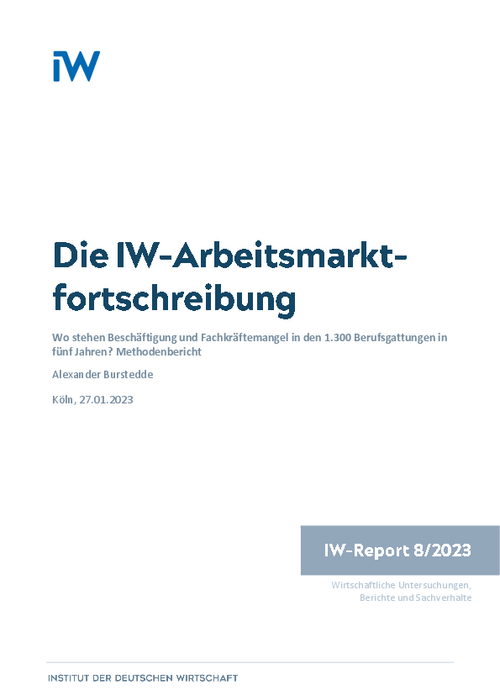
Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung: Wo stehen Beschäftigung und Fachkräftemangel in den 1.300 Berufsgattungen in fünf Jahren?

In dieser Studie wird eine Methodik beschrieben, mit der die Entwicklung von Beschäftigung und Fachkräftemangel fünf Jahre in die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Dabei wird angenommen, dass sich die empirisch feststellbaren Trends der jüngeren Vergangenheit unverändert fortsetzen. Die Berechnung von Alternativszenarien mit veränderten Trends ist möglich.
Die Entwicklung des Arbeitsmarktes wird in dieser Studie sehr kleinteilig berechnet bzw. stark disaggregiert (Bottom-Up-Prinzip). Insbesondere die berufliche Differenzierung erfolgt in einer für eine solche Fortschreibung neuem Detailgrad. Damit ist diese Methodik komplementär zum QuBe-Projekt (BIBB, 2022a) zu sehen, dessen Modellierung des Arbeitsmarktes insgesamt umfangreicher ist, bei der beruflichen Differenzierung jedoch deutlich gröber bleibt. Durch die erhöhte berufliche Differenzierung lassen sich nun auch Entwicklungen in Teilarbeitsmärkten erkennen, die sonst unentdeckt blieben. Insbesondere können unterschiedliche Entwicklungen einzelner Berufe derselben Berufsgruppe differenziert betrachtet werden.
In der Methodik ist außerdem angelegt, die Treiber von Entwicklungen quantifizieren zu können. Dafür werden die Entwicklungen von Arbeitsangebot und -nachfrage in Komponenten zerlegt, die einzeln fortgeschrieben werden können. Aus der Vielzahl an Komponenten lässt sich schließlich wieder ein aggregiertes Gesamtbild zusammensetzen, das alle kleinteiligen Entwicklungen berücksichtigt. Für jede Komponente kann ein Wachstumsbeitrag berechnet werden, der deren Anteil an der aggregierten Entwicklung wiedergibt, beispielsweise wie sich Zuwanderung auf das Arbeitsangebot auswirkt.
Die Zukunft ist unvorhersehbar und die Fortschreibungen sind daher nicht als Prognosen zu verstehen. Sie beschreiben den Pfad, auf dem sich der Arbeitsmarkt aktuell befindet, wenn sich keine Trendänderungen ergeben. Die Fortschreibungen dienen primär der Identifikation bestehender Handlungsbedarfe. Eine Vorhersage von Trendänderungen ist nicht vorgesehen und auch kaum möglich. Die Fortschreibungen können jährlich wiederholt werden und der Abgleich mit früheren Fortschreibungen erlaubt Rückschlüsse auf Trendänderungen. So können neue oder sich verändernde Handlungsbedarfe identifiziert werden.
Die Umsetzung von Handlungsbedarfen kann schließlich mit Alternativszenarien modelliert werden, um deren zu erwartende Effektivität abschätzen zu können. So kann ex-ante evaluiert werden, wie groß die Effekte einzelner Maßnahmen auf die Fachkräftesituation sein könnten. Während sich die IW-Arbeitsmarktfortschreibung vollständig aus den in den Daten vorliegenden empirischen Trends ergibt, müssen für Alternativszenarien Annahmen über abweichende Trends getroffen werden. Die Plausibilität dieser Annahmen bestimmt den Wert der resultierenden Aussagen.
Der Fachkräftemangel beschäftigt die deutsche Wirtschaft schon seit vielen Jahren. Es gibt vielfältige Analysen der aktuellen und der künftigen Fachkräftesituation, die jedoch häufig kein schlüssiges Gesamtbild zeichnen können. So ist es beispielsweise unzureichend, lediglich die Arbeitsnachfrage zu betrachten, nach Absichten und Wahrnehmungen zu fragen oder einzelne Teilarbeitsmärkte aus Sicht nur einer Branche isoliert zu betrachten. Anspruch dieser Studie ist es, die Gesamtanzahl der Beschäftigten in Deutschland heute und in Zukunft zu ermitteln, deren Verteilung auf die einzelnen Berufe zu beschreiben sowie Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage gegenüberzustellen. Soweit bekannt erfüllt diese Anforderungen bislang einzig das QuBe-Projekt mit seinen Qualifikations- und Berufsprojektionen (BIBB, 2022a) sowie die auf dessen Basisszenario aufbauenden Alternativszenarien des BMAS-Fachkräftemonitorings (Zika et al., 2022). Auf das QuBe-Projekt wird in Kapitel 2 detailliert eingegangen.
Zusammengefasst verfolgte die Entwicklung der hier vorgestellten Methodik folgende Ziele:
- Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung soll aufzeigen, auf welchem Entwicklungspfad Beschäftigung und Fachkräftemangel aktuell sind.
- Die Berechnung erfolgt disaggregiert auf Ebene von 1.300 Berufsgattungen.
- Der demografische Wandel wird detailliert berücksichtigt.
- Die Fortschreibungen sind möglichst einfach nachvollziehbar.
- Die Ergebnisse sind regionalisierbar.
- Es werden absolute Zahlen für Beschäftigte und Fachkräftelücke berechnet.
- Aus den Ergebnissen lassen sich politische Handlungsbedarfe ableiten.
- Alternativszenarien können die Auswirkungen von Trendänderungen simulieren.
Das folgende Kapitel 2 beschreibt bestehende Bevölkerungs- und Arbeitsmarktprognosen und leitet daraus Richtlinien für die Entwicklung der in Kapitel 3 vorgestellten Methodik der IW-Arbeitsmarktfortschreibung ab. Kapitel 4 stellt die Ergebnisse vor. Kapitel 5 fasst die zentralen Ergebnisse und deren Einflussfaktoren sowie mögliche Weiterentwicklungen der Methodik zusammen.
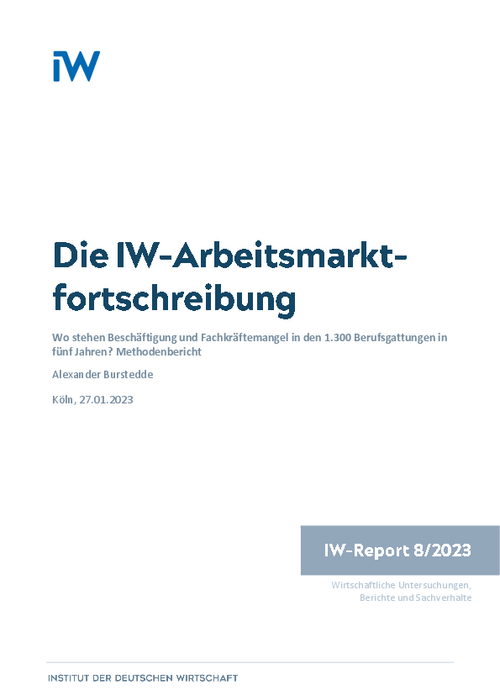
Die IW-Arbeitsmarktfortschreibung: Wo stehen Beschäftigung und Fachkräftemangel in den 1.300 Berufsgattungen in fünf Jahren?


Steuerrabatte für Ausländer: Jährliche Kosten von 600 Millionen Euro
Die Debatte um Steuervergünstigungen für ausländische Fachkräfte erhitzt weiter die Gemüter. Die Steuergeschenke würden nach neuen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bis zu 600 Millionen Euro kosten – und dabei wenig bringen.
IW
Steuerrabatte für ausländische Fachkräfte sind keine Lösung
Mit Steuervergünstigungen will die Bundesregierung ausländische Fachkräfte nach Deutschland locken. Damit verfolgt sie das richtige Ziel, setzt aber an der falschen Stelle an. Vor allem zu lange Visumverfahren bremsen den Zuzug nach Deutschland aus.
IW