Die Ampelparteien streiten bei ihren Koalitionsverhandlungen vor allem um die Finanzen. Grüne und SPD wollen Investitionen abseits der Schuldenbremse, die FDP zieht nicht mit. Doch die Partner könnten auch ohne Schulden oder breite Steuererhöhungen an mehr Geld kommen, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt.

Haushalt: Wie die Bundesregierung an zusätzliche 95 Milliarden Euro kommt
Noch immer ringen SPD, Grüne und FDP in Berlin um eine Ampel-Koalition, doch von der anfänglich optimistischen Stimmung scheint wenig übriggeblieben zu sein. Vor allem beim Thema Finanzen dürfte es am Verhandlungstisch krachen; SPD und Grüne würden gerne abseits der Schuldenbremse investieren und die Steuern erhöhen, die FDP hat beides im Vorfeld abgelehnt. Es stellt sich die Frage, wie die Koalitionspartner nun an das nötige Geld für ihre Vorhaben kommen wollen. Eine neue IW-Auswertung hat verschiedene Stellschrauben identifiziert, an denen die neue Regierung drehen könnte: darunter Steuermehreinnahmen, ein längerer Tilgungszeitraum für die Corona-Schulden und der Verkauf von Beteiligungen. Von 2023 bis 2025 könnten so 95 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Im Jahr 2022 stellt sich das Finanzierungsproblem kaum noch, da die normalen Verschuldungsregeln der Schuldenbremse ausgesetzt sind. Doch ab 2023 wird die Schuldenbremse Stand heute wieder regulär greifen.
Steuereinnahmen dürften kräftig steigen
Besonders die Steuermehreinnahmen werden den Haushaltsspielraum erhöhen. Laut Steuerschätzung kann der Bund in den kommenden Jahren mit höheren Einnahmen rechnen als bisher in der Finanzplanung unterstellt. Zudem könnte sich die geplante Mindeststeuer in der Kasse bemerkbar machen. Und auch eine mögliche Cannabislegalisierung könnte laut einer kürzlich erschienenen Studie des „Düsseldorf Institute for Competition Economics“ Geld in die Kassen spülen. Summiert man diese Mehreinnahmen auf, werden dem Bund zwischen 2023 und 2025 rund 50 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen. Würde die Regierung den Tilgungsplan der Coronaschulden auf 40 statt 20 Jahre strecken, kommt rund eine Milliarde jährlich dazu. Ab dem Jahr 2026 würde sich die Tilgungsrate sogar um schätzungsweise zehn Milliarden Euro pro Jahr reduzieren. Auch ein Blick auf die Ausgaben lohnt sich: Sozialausgaben und Subventionen sind in jüngerer Vergangenheit deutlich gestiegen.
Von Beteiligungen trennen
Würde die Bundesregierung darüber hinaus ihre Beteiligungen an der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Post AG abstoßen, könnten die Koalitionäre einmalig rund 25 Milliarden Euro einnehmen – über die KfW würden weitere 15 Milliarden dazukommen. „Insgesamt stünden so zwar 95 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung“, so Studienautor und Finanzexperte Tobias Hentze. „Das reicht aber bei weitem nicht aus, um die großen Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen. Da eine Reform der Schuldenbremse keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag finden dürfte, ist ein rechtlich selbstständiger Investitionsfonds der richtige Weg, um den Strukturwandel zu ermöglichen.“
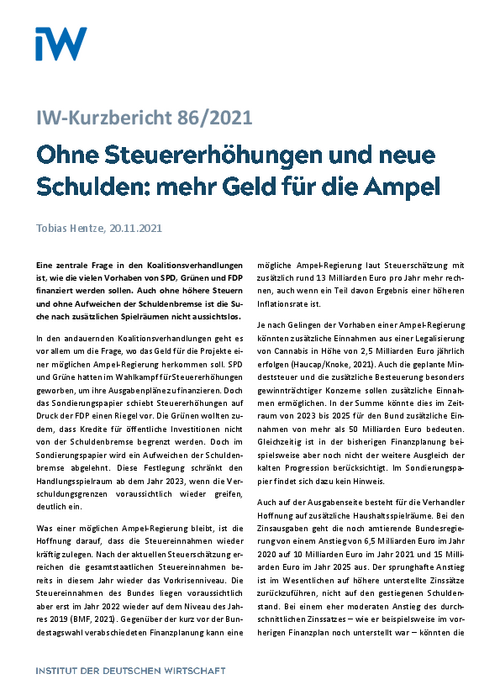
Ohne Steuererhöhungen und neue Schulden: mehr Geld für die Ampel


Bundeshaushalt 2025: Getrickst, verschleppt und teuer erkauft
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute den Haushaltsplan für das kommende Jahr im Bundestag vorgestellt. Das Ergebnis ist unausgeglichen: Probleme werden in die Zukunft verlagert und Investitionen bleiben auf der Strecke.
IW
Haushaltseinigung: Kein Problem wirklich gelöst
Nach langem Streit hat die Bundesregierung sich heute auf einen Haushaltsrahmen für 2025 geeinigt – und vor lauter Streit die eigentlichen Herausforderungen übersehen, schreibt IW-Direktor Michael Hüther in einem Gastbeitrag für ZEIT online.
IW