Durch die steigende Lebenserwartung wird sich die Rentenbezugsdauer und damit die Anzahl der jährlich zu versorgenden Ruheständler in der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) erhöhen.
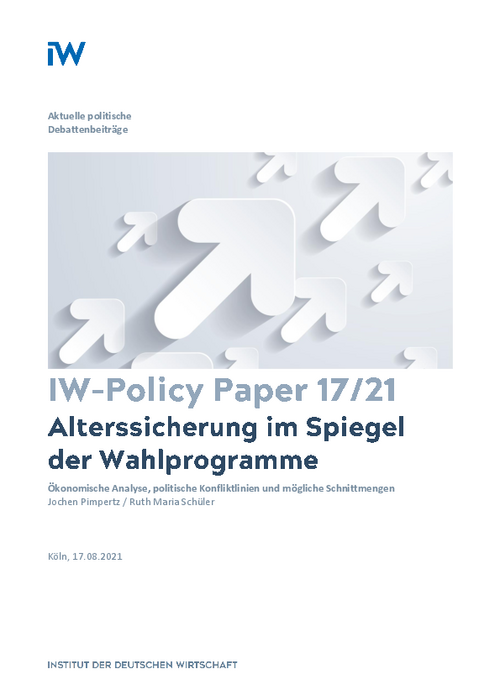
Alterssicherung im Spiegel der Wahlprogramme

Durch die steigende Lebenserwartung wird sich die Rentenbezugsdauer und damit die Anzahl der jährlich zu versorgenden Ruheständler in der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) erhöhen.
Zudem beschleunigt die alternde Babyboomer-Generation schon in den nächsten Jahren den Anstieg der Rentnerzahl. Gleichzeitig werden aufgrund der niedrigen Geburtenziffern immer weniger Versicherte in das umlagefinanzierte System einzahlen. Für die kommende Legislaturperiode besteht deshalb die Aufgabe darin, die Finanzierung der gesetzlichen Rentenansprüche nachhaltig zu sichern und dabei die intergenerative Balance zu wahren.
Dafür ist eine langfristige Anhebung der Regelaltersgrenze unverzichtbar, weil der erwartete Anstieg des Beitragssatzes nicht nur gebremst, sondern dieser ab dem Jahr 2040 dauerhaft unter der 22-Prozent-Marke stabilisiert werden kann. Gleichzeitig ließe sich ein Sicherungsniveau von über 46 Prozent langfristig realisieren. Doch in den Wahlprogrammen von CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD finden sich dazu keine Vorschläge, DIE LINKE fordert sogar eine Rückkehr zur „Rente mit 65“. Die Liberalen plädieren für eine Flexibilisierung des Renteneintritts, setzten dabei aber auf Anreize zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Die infolge der Corona-Pandemie wirksame Rentengarantie verschärft das Problem der intergenerativen Lastverschiebung zusätzlich, weil der Nachholfaktor bis 2025 ausgesetzt ist. Diese Fehlentwicklung ließe sich durch ein sofortiges Reaktivieren des Faktors korrigieren – dafür plädiert aber nur die FDP.
Stattdessen fordern Bündnis 90/Die Grünen und SPD ein langfristiges Sicherungsniveau von 48 Prozent, DIE LINKE will es sogar auf 53 Prozent erhöhen. Den Beitragszahlern drohen damit nochmals höhere Lasten. Die drei Parteien wollen unter anderem mit einem Ausbau der GRV zu einer Erwerbstätigenversicherung für Entlastung sorgen. Allerdings würde damit die Lösung des intergenerativen Verteilungsproblems lediglich in die Zukunft verschoben. Eine dauerhafte Lösung demografischer Probleme verspricht dieser Weg aber nicht. Der Übergang zu einer Erwerbstätigenversicherung sollte – wenn überhaupt – über lange Fristen geplant werden, ohne diese Option mit Zielen der Armutsprävention zu überfrachten.
DIE LINKE fordert eine Abschaffung der geförderten Privatvorsorge, die betriebliche Altersvorsorge (bAV) solle eine freiwillige, arbeitgeberfinanzierte Leistung sein. Die übrigen Parteien setzen weiterhin auf die ergänzenden Säulen der Alterssicherung und fordern dazu (mit Einschränkung die FDP) eine verpflichtende Vorsorge mit der Möglichkeit des Opt-out. Diese soll in einem Bürgerfonds (Bündnis 90/Die Grünen) organisiert oder durch ein staatliches Standardvorsorgeprodukt (zum Beispiel CDU/CSU) umgesetzt werden. Ein Obligatorium ist aber nicht nur ineffizient, weil damit Bildungs- und Vorsorgeentscheidungen der Bürger verzerrt werden können. Es provoziert auch die Frage nach der Legitimation staatlich initiierten Zwangssparens jenseits der Sozialversicherungspflicht. Dem Vorwurf zu hoher Verwaltungskosten ließe sich stattdessen mit dem Angebot einer staatlich organisierten Anlagealternative effektiv begegnen. Einer verpflichtenden Einzahlung in einen Staatsfonds bedarf es dazu nicht. Die Förderung ergänzender Vorsorge sollte treffsicher zugunsten niedriger Einkommen organisiert werden (SPD), aber neutral bezüglich der Anlageform erfolgen (FDP).
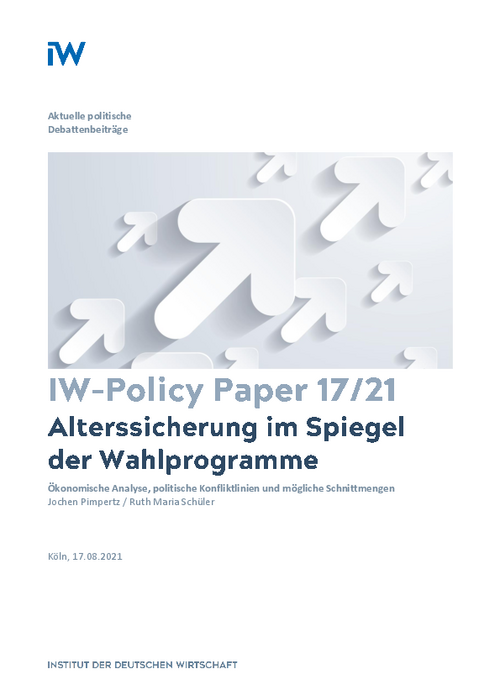
Alterssicherung im Spiegel der Wahlprogramme


Rentenpolitik für oder mit alternden Mehrheiten?
Die Bevölkerung altert und die Versorgungsinteressen der betagten Bürger rücken damit zunehmend in den Mittelpunkt der Politik.
IW
Politische Ökonomie der Rentenreform
Die Alterung der deutschen Bevölkerung führt in der umlagefinanzierten Gesetzlichen Rentenversicherung zu höheren Beiträgen bei sinkendem Sicherungsniveau. Dies ließe sich bremsen, wenn mit steigender Regelaltersgrenze der Renteneintritt später erfolgte.
IW