Die Europäische Union will der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa mit milliardenschweren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen begegnen. Sie werden das Problem jedoch nicht lösen können. Außerdem sind die Zahlen zur hohen Jugendarbeitslosigkeit auch ein Ergebnis der unvollständigen Statistik.
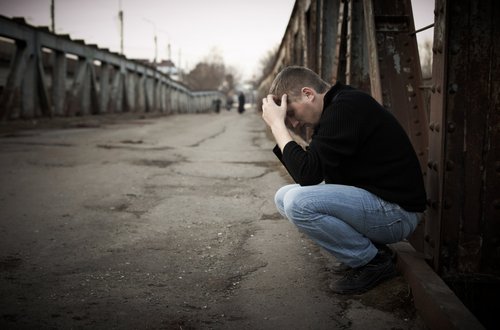
Geplante Maßnahmen lösen das Problem nicht
In allen europäischen Ländern haben es Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt schwerer als Ältere. Das ist keineswegs ein neues Phänomen, sondern schon seit Jahrzehnten zu beobachten. Ein Grund dafür ist, dass Betriebe in Krisenzeiten auf Einstellungen verzichten. Deshalb findet die Jugend keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Zudem spielt ein statistisches Phänomen eine Rolle: Schüler und Studenten werden bei der Berechnung der Jugendarbeitslosenquote nicht mitgezählt, sondern nur all jene, die dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen. Das verfälscht das Bild, denn gerade jene mit langer Ausbildung haben später bekanntlich viel bessere Chancen, einen Job zu finden.
So ist die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel in Griechenland in der Krise auf 60 Prozent angestiegen – was allerdings nicht heißt, das 60 Prozent der jungen Griechen arbeitslos sind: Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in diesem Alter, also inklusive Schüler und Studenten, beträgt der Anteil arbeitsloser Jugendlicher in Griechenland lediglich 15 Prozent. Schlimmer ist die Lage in Spanien, wo 20 Prozent der Jugendlichen vergeblich nach Arbeit suchen.
In vielen Ländern wird versucht, arbeitslose Jugendliche mit Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik in einen Job zu bringen – zum Beispiel mit Qualifizierungsmaßnahmen. Ob so etwas sinnvoll ist, hängt immer vom Einzelfall ab. In den südeuropäischen Krisenländern ist die Arbeitslosigkeit jedoch vorwiegend krisenbedingt oder von ineffizienten Institutionen mitverursacht. Diese grundsätzlichen Probleme kann Arbeitsmarktpolitik nicht lösen – nicht einmal, wenn die Politik noch wesentlich mehr Geld ausgibt.

Berliner Gespräche Frühjahrstagung: Zwischen Sicherheitspolitik, Green Deal und Wettbewerbsfähigkeit – eine europapolitische Bestandsaufnahme
Das Institut der deutschen Wirtschaft möchte Sie erneut zu einer virtuellen Variante der „Berliner Gespräche” einladen.
IW
Die Zukunft Europas: Welche Prioritäten sind für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend?
Die Europäische Union hat ihre neue strategische Agenda für die Jahre 2024 bis 2029 veröffentlicht. IW-Direktor Michael Hüther und HRI-Präsident Bert Rürup analysieren im Handelsblatt-Podcast „Economic Challenges” die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit für die ...
IW