Aufgrund des starken Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum deutlich reduziert. Doch ist Wohneigentum damit auch im längerfristigen Vergleich unerschwinglich?
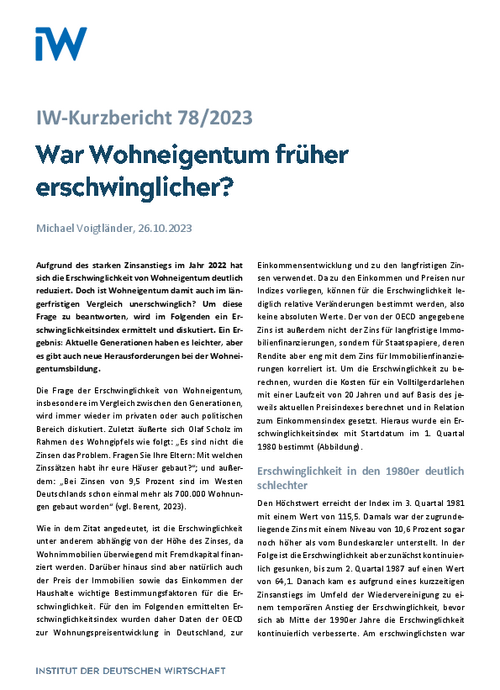
War Wohneigentum früher erschwinglicher?

Aufgrund des starken Zinsanstiegs im Jahr 2022 hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum deutlich reduziert. Doch ist Wohneigentum damit auch im längerfristigen Vergleich unerschwinglich?
Um diese Frage zu beantworten, wird im Folgenden ein Erschwinglichkeitsindex ermittelt und diskutiert. Ein Ergebnis: Aktuelle Generationen haben es leichter, aber es gibt auch neue Herausforderungen bei der Wohneigentumsbildung.
Die Frage der Erschwinglichkeit von Wohneigentum, insbesondere im Vergleich zwischen den Generationen, wird immer wieder im privaten oder auch politischen Bereich diskutiert. Zuletzt äußerte sich Olaf Scholz im Rahmen des Wohngipfels wie folgt: „Es sind nicht die Zinsen das Problem. Fragen Sie Ihre Eltern: Mit welchen Zinssätzen habt ihr eure Häuser gebaut?“; und außerdem: „Bei Zinsen von 9,5 Prozent sind im Westen Deutschlands schon einmal mehr als 700.000 Wohnungen gebaut worden“ (vgl. Berent, 2023).
Wie in dem Zitat angedeutet, ist die Erschwinglichkeit unter anderem abhängig von der Höhe des Zinses, da Wohnimmobilien überwiegend mit Fremdkapital finanziert werden. Darüber hinaus sind aber natürlich auch der Preis der Immobilien sowie das Einkommen der Haushalte wichtige Bestimmungsfaktoren für die Erschwinglichkeit. Für den im Folgenden ermittelten Erschwinglichkeitsindex wurden daher Daten der OECD zur Wohnungspreisentwicklung in Deutschland, zur Einkommensentwicklung und zu den langfristigen Zinsen verwendet. Da zu den Einkommen und Preisen nur Indizes vorliegen, können für die Erschwinglichkeit lediglich relative Veränderungen bestimmt werden, also keine absoluten Werte. Der von der OECD angegebene Zins ist außerdem nicht der Zins für langfristige Immobilienfinanzierungen, sondern für Staatspapiere, deren Rendite aber eng mit dem Zins für Immobilienfinanzierungen korreliert ist. Um die Erschwinglichkeit zu berechnen, wurden die Kosten für ein Volltilgerdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren und auf Basis des jeweils aktuellen Preisindexes berechnet und in Relation zum Einkommensindex gesetzt. Hieraus wurde ein Erschwinglichkeitsindex mit Startdatum im 1. Quartal 1980 bestimmt (Abbildung).
Erschwinglichkeit in den 1980er deutlich schlechter
Den Höchstwert erreicht der Index im 3. Quartal 1981 mit einem Wert von 115,5. Damals war der zugrundeliegende Zins mit einem Niveau von 10,6 Prozent sogar noch höher als vom Bundeskanzler unterstellt. In der Folge ist die Erschwinglichkeit aber zunächst kontinuierlich gesunken, bis zum 2. Quartal 1987 auf einen Wert von 64,1. Danach kam es aufgrund eines kurzzeitigen Zinsanstiegs im Umfeld der Wiedervereinigung zu einem temporären Anstieg der Erschwinglichkeit, bevor sich ab Mitte der 1990er Jahre die Erschwinglichkeit kontinuierlich verbesserte. Am erschwinglichsten war Wohneigentum dann im 3. Quartal 2016 mit einem Wert von 28,6. Nachdem sich daraufhin die Erschwinglichkeit zunächst seitwärts bewegt hat, gibt es seit 2021 deutliche Verschlechterungen. Im 2. Quartal 2023 liegt der Index nun bei 41,0.
Gründe für die höhere Erschwinglichkeit
Wesentlich für die vorteilhafte Entwicklung der Erschwinglichkeit seit den 1980er Jahren ist insbesondere die Zinsentwicklung. Aufgrund des Rückgangs der Inflation haben sich auch die Zinsen reduziert, was die Erschwinglichkeit deutlich erhöht. Darüber hinaus war gerade in den 1990er Jahren die Bautätigkeit zu hoch, es entstand damit ein Überangebot, was zu einer Seitwärtsbewegung der Preise bis Mitte der 2000er Jahre führte. Da aber die Einkommen weiter gestiegen sind, hat sich die Erschwinglichkeit zusätzlich verbessert. In den 2010er Jahren sind dann die Preise wieder schneller gestiegen, dies wurde aber durch die noch stärkeren Zinssenkungen überkompensiert – bis zum Jahr 2022, als aufgrund des starken Anstiegs der Inflation auch die Zinsen deutlich zulegten, so dass sich der Indexwert um mehr als 10 Punkte oder aber mehr als 30 Prozent verschlechterte (vgl. auch Sagner, 2023).
Warum ist die Wohneigentumsquote nicht stärker gestiegen?
Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse, dass die Erschwinglichkeit heute immer noch deutlich besser ist als in den 1980er und 1990er Jahren. In etwa liegt die Erschwinglichkeit heute auf dem Niveau von Mitte der 2000er Jahre. Dieses Ergebnis dürfte für zahlreiche Menschen kontraintuitiv sein, da die Vorstellung vorherrscht, dass es frühere Generationen leichter hatten, Wohneigentum zu bilden. Und tatsächlich zeichnet auch die Wohneigentumsstatistik ein anderes Bild. So stieg zwar die Wohneigentumsquote in den 1980er bis Mitte der 2000er Jahre, doch insbesondere in den 2010er Jahren, als die Erschwinglichkeit sich deutlich verbesserte, blieb sie konstant. Jedoch sind zur Einordnung der Erschwinglichkeit auch die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: Erstens war in den 1980er und auch 1990er Jahren die Inflation noch relativ hoch. Dies bedeutete für die Käufer oftmals auch, dass sie mit relativ starken Einkommenssteigerungen rechnen konnten. Viele Haushalte haben sich daher in den ersten Jahren auf eine hohe Belastung eingestellt, rechneten aber damit, dass sich die Höhe der Kreditraten entwertet und sie sich dann wieder mehr leisten können. Zweitens waren früher auch Eigenleistungen („Muskelhypothek“) deutlich üblicher und leichter realisierbar, als dies heute aufgrund komplexerer Techniken der Fall ist. Drittens wird der Zeitpunkt des Einkommenserwerbs heute aufgrund von längerer Ausbildung und späterer Familiengründung zeitlich nach hinten geschoben. Damit steigen die Raten, da in kürzerer Zeit getilgt werden muss. Insbesondere in den Großstädten und deren Umland liegt das Durchschnittsalter des Haushaltsvorstands bei Familien mit Kindern bei 41 Jahren (vgl. Amann, 2019). Viertens ist das Eigenkapital sehr wichtig. Erwerbsnebenkosten wie die Grunderwerbsteuer, Maklerleistungen und Notarkosten können nicht finanziert werden und müssen daher durch Ersparnisse bezahlt werden. Dazu erwarten die meisten Banken, dass die Kunden auch Eigenkapital in die Finanzierung einbringen. Dieser Kapitalbedarf ist proportional zu den Kaufpreisen, womit der Kapitalbedarf stark gestiegen ist, zumal in den meisten Bundesländern auch noch die Grunderwerbsteuersätze erhöht wurden. Auf der anderen Seite erschweren niedrigere Zinsen die Ersparnisbildung. 2018 hatten nur 15 Prozent der Mieter ein Finanzvermögen von mehr als 60.000 Euro und dürften somit kaum Chancen auf den Erwerb von Wohneigentum haben (vgl. Sagner/Voigtländer, 2021). Fünftens schließlich spielt auch die Wohnfläche eine bedeutsame Rolle. Noch 1991 lag die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner bei 34,9 m2, 2020 waren es schon 47,7 m2. Allerdings ist auch zu beachten, dass der Flächenkonsum pro Kopf vor allem dadurch steigt, dass ältere Menschen auch dann in ihren Wohnungen bleiben, wenn etwa die Kinder schon ausgezogen sind.
Ausblick und Handlungsoptionen
Die aufgelisteten Punkte verdeutlichen, dass der Erschwinglichkeitsindex nicht allein die Zugänglichkeit zu Wohneigentum beschreiben kann. Insbesondere der Zugang zu Eigenkapital ist ebenfalls zu berücksichtigen, auch vor dem Hintergrund späterer Familiengründungen. Nichtsdestotrotz verdeutlicht der Erschwinglichkeitsindex aber, dass sich die Lage für Wohneigentümer zwar deutlich verschlechtert hat, sie aber im langfristigen Mittel immer noch gut ist und sich am aktuellen Rand aufgrund steigender Einkommen bei leicht fallenden Preisen wieder verbessert. Mit Blick auf die aktuelle Wohnungsbaukrise können somit Selbstnutzer ein stabilisierender Faktor sein, sofern die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Mit der Ermöglichung von Nachrangdarlehen über die KfW, die als Eigenkapitalersatz genutzt werden können, ist die Bundesregierung einen richtigen Schritt gegangen. Zu bemängeln ist aber, dass die Einkommensgrenzen mit einem Betrag von 90.000 Euro für eine dreiköpfige Familie immer noch knapp bemessen sind. Zudem ist zu kritisieren, dass solche Darlehen nach wie vor nur für besonders energieeffiziente Immobilien gewährt werden – notwendig wäre aber eine Öffnung des Programms für alle Neubauten. Unbefriedigend ist darüber hinaus, dass es immer noch keine Einigung zwischen Bund und Ländern hinsichtlich der Grunderwerbsteuer gibt. Schließlich könnte ein Freibetrag sowohl den Eigenkapitalbedarf als auch die Belastung aus der Finanzierung senken (Sagner, 2023). Schließlich gilt aber auch, dass der wesentliche Engpassfaktor für den Wohnungsbau in den 2010er Jahren das Bauland war. Entsprechend sollte gerade jetzt die Ausweisung von Bauland hochgehalten werden, denn dies trägt einerseits über günstigere Baulandpreise zu geringeren Hauspreisentwicklungen bei und eröffnet erst die Möglichkeit, dass auch Selbstnutzer als Bauherren ihren Wohneigentumswunsch verwirklichen können.
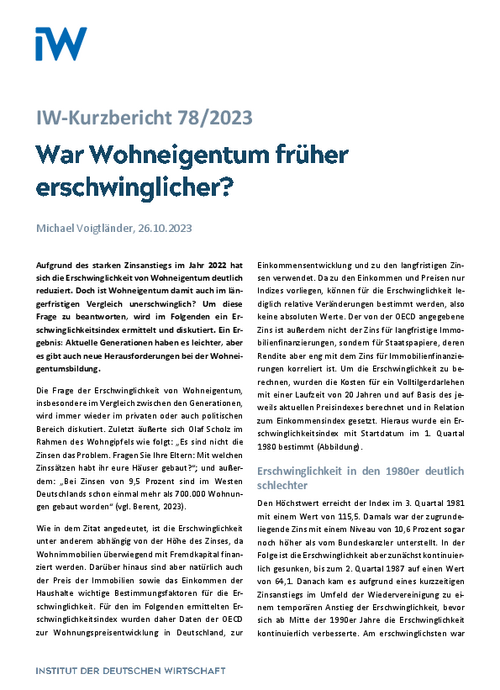
War Wohneigentum früher erschwinglicher?


Was lohnt sich mehr, Aktien oder Immobilien?
Über die Frage, was sich für Anleger mehr lohnt, in Aktien oder Immobilien zu investieren, diskutiert IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer im 1aLage Podcast und spricht über grundsätzliche Unterschiede und Besonderheiten und wie es die reichen Haushalte ...
IW
Sanierungspotenziale von Wohnimmobilien in Deutschland
Deutschland hat ehrgeizige Pläne und möchte bis 2045 Klimaneutralität erreichen. Ein zentraler Baustein dieser Bestrebungen ist die drastische Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
IW