Die Europäische Union wurde zu Beginn des neuen institutionellen Zyklus, als es mit der programmatischen Ausrichtung losgehen sollte, von der COVID-19-Pandemie ausgebremst. Das Wahlergebnis zum Europaparlament hatte die Befürchtungen, Europaskepsis würde zum Signum der kommenden Periode, nicht erfüllt.
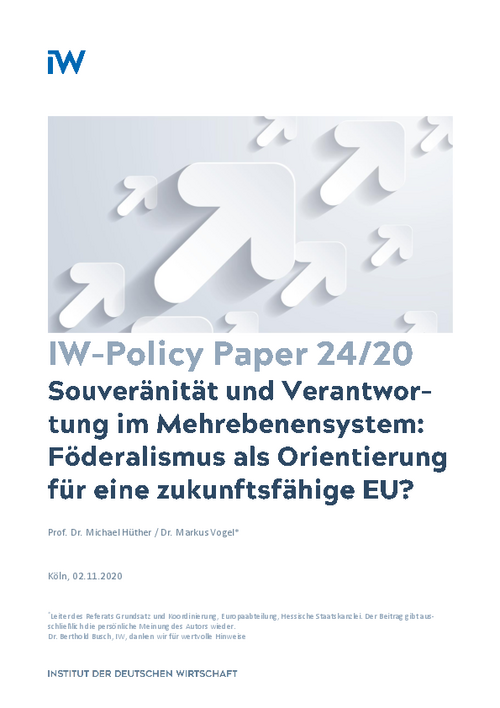
Souveränität und Verantwortung im Mehrebenensystem: Föderalismus als Orientierung für eine zukunftsfähige EU?
IW Policy Paper

Die Europäische Union wurde zu Beginn des neuen institutionellen Zyklus, als es mit der programmatischen Ausrichtung losgehen sollte, von der COVID-19-Pandemie ausgebremst. Das Wahlergebnis zum Europaparlament hatte die Befürchtungen, Europaskepsis würde zum Signum der kommenden Periode, nicht erfüllt.
Auch die Corona-Bewährungsprobe für die Handlungsfähigkeit der Union scheint nach kurzfristiger Rückbesinnung auf die Pandemiebewältigung vor Ort, die bis zur Schließung von Grenzen führte, gut überwunden; während der zweiten Lockdown-Phase im Herbst 2020 soll jedenfalls eine Grenzschließung um jeden Preis vermieden werden. Dennoch deutet die zunehmende Differenzierung der europapolitischen Perspektiven in den Mitgliedstaaten darauf hin, dass ein Weiter so nicht tragen wird, dass die nächsten Schritte der Integration konkrete Antworten auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger enthalten müssen. Eine neue Debatte um die Zukunft der Europäischen Union ist längst in Gang gekommen, eine interinstitutionelle Konferenz zur Zukunft der EU hätte längst starten sollen und wartet nun auf ihren baldigen Auftakt. Ein in der deutschen Öffentlichkeit und Politik hochgewichteter Maßstab für die Zuständigkeitsvermutung im europäischen Mehrebenensystem ist das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 3 EUV).
Der Blick in die juristische und die ökonomische Debatte zum Subsidiaritätsprinzip als Regulativ für die Kompetenzordnung und die Allokationseffizienz bleibt einigermaßen unbefriedigend, und auch der dilatorische Blick auf die föderalen Elemente der EU hilft zunächst nicht weiter. In diesem Mehrebenensystem kollidieren historisch divergierende, systematisch inkonsistente und qualitativ unterschiedliche Bedürfnisse, die in einen Ausgleich zu bringen sind. Daraus ergibt sich ein Werben für eine „aktive Subsidiarität“ und eine „Subsidiaritätsroutine“, um das Miteinander im heterogenen EU-Mehrebenensystem mit differenzierten nationalen staatlichen Ordnungen sowie unterschiedlichen territorialen Bezügen dynamisch zu gestalten. Damit kann es gelingen, immer wieder einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger – Akzeptanz –, der EU-Institutionen – Effizienz – sowie der verschiedenen Entscheidungs- und Gestaltungsebenen – Daseinsberechtigung – zu finden. Vor allem aber: Subsidiarität beginnt zuhause, d.h. sie kann in EU nur stark gemacht werden, wenn sie in den Mitgliedsstaaten nicht erodiert. Hier liegt eine bislang häufig übersehene Herausforderung.
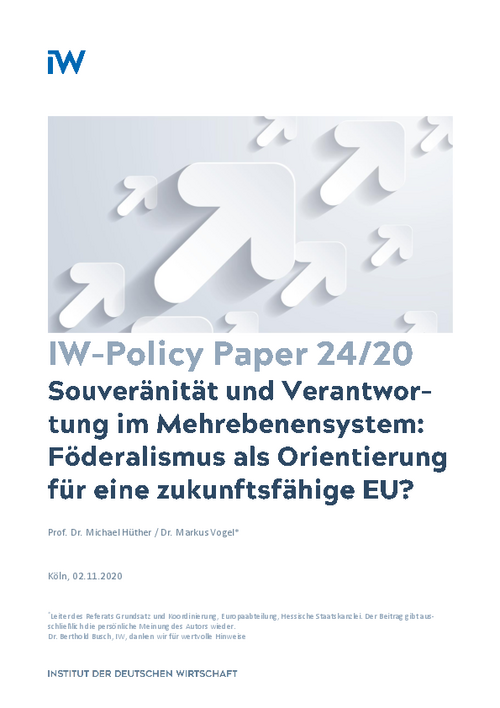
Prof. Dr. Michael Hüther / Dr. Markus Vogel: Souveränität und Verantwortung im Mehrebenensystem – Föderalismus als Orientierung für eine zukunftsfähige EU?
IW Policy Paper


Inflation in der Eurozone: Der Weg bleibt holprig
Die Inflation in der Eurozone befindet sich auf dem Rückzug. Ein Aufatmen wäre aber verfrüht. Zweitrundeneffekte im Arbeitsmarkt sind im vollen Gange und setzen die Geldpolitik weiter unter Druck.
IW
Trump oder Harris oder …? Worauf sich Europa einstellen muss
Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Donald Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl. Auf Seiten der Demokraten hat der amtierende Präsident seine Kandidatur nach langem Zögern zurückgezogen, Vizepräsidentin Kamala Harris wird mit hoher ...
IW