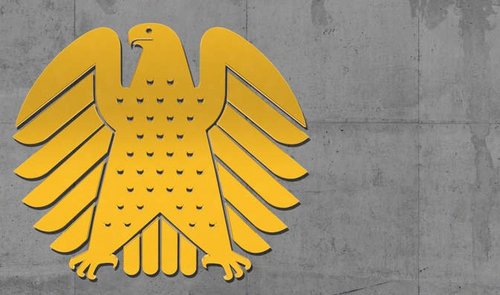Die Bundesregierung hat ein gigantisches Sparpaket geschnürt – aber was heißt das für die Konjunktur? Würgt Schwarz-Gelb den Aufschwung ab, oder sorgt das Programm für einen neuen Wachstumsschub?
Sparen wir uns kaputt?
Das Sparpaket der Bundesregierung hat durchaus gute Seiten, ein Absturz der Konjunktur ist nicht zu befürchten. Im Gegenteil: Wer richtig spart, kann das Wachstum sogar ankurbeln. Allerdings hat Schwarz-Gelb auch vieles falsch gemacht.
Es ist wie ein Reflex: Kaum legt die Regierung ein Konsolidierungsprogramm auf, ertönt ein Aufschrei der Kritik. Das Sparpaket sei sozial unausgewogen – und es belaste die Konjunktur. Als Helmut Schmidt die "Operation ’82" zur Sanierung des Bundeshaushalts stemmte, errechneten sogenannte Experten sogleich, dass dies die ohnehin geplagte Konjunktur mindestens mit einem halben Prozentpunkt Wachstumsverlust belasten würde. Tatsächlich hat aber schon kurz danach der beständige Aufschwung der achtziger Jahre eingesetzt.
Internationale Studien können dies leicht erklären: Wenn die Last der Staatsschulden als drückend wahrgenommen wird und die Handlungsfähigkeit des Staats aufgrund der Zinsverpflichtungen gefährdet erscheint, dann nehmen die Bürger jede ernstgemeinte Sparbemühung als Erleichterung wahr. Mit anderen Worten: Eine wachstumsorientierte Konsolidierung der öffentlichen Haushalte schafft Zukunftsvertrauen.
Wachstumsorientiert ist nach diesen Erkenntnissen eine Strategie, die allgemeine Steuererhöhungen vermeidet und die investiven Ausgaben im öffentlichen Haushalt schont. Konsolidierung muss, um positive Erwartungen bei Konsumenten und Investoren auszulösen, mutig sein. Wer kleinmütig beginnt, der kann kaum mit Begeisterung rechnen. Die Erfahrung zeigt, dass ein wachstumsorientiertes Sparpaket schon in kurzer Frist positiv auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik wirkt. Die privaten Akteure schöpfen Vertrauen und treffen entsprechend ihre persönlichen Ausgabenentscheidungen – was die Konjunktur ankurbelt. Dass der Staat gleichzeitig weniger Geld ausgibt, wird durch den Vertrauenseffekt überkompensiert.
Wie ist daran gemessen die Sparliste der Bundesregierung zu werten? Breit wirkende Steuererhöhungen gibt es nicht, das ist eine gute Nachricht. Dies gilt ebenso für die Tatsache, dass die Ausgaben für Bildung und Wissenschaft sowie Infrastruktur nicht verringert werden. Der Schwerpunkt der Einsparungen liegt im Bereich der konsumtiven Ausgaben, was den allfälligen Vorwurf der sozialen Schieflage provoziert. Tatsächlich aber führen gerade die Veränderungen beim Arbeitslosengeld II dazu, dass die Anreize zur Arbeitsaufnahme verbessert werden. Das sorgt für mehr Fairness bei der sozialen Grundsicherung – und entlastet Arbeitsmarkt wie Konjunktur. Auch die Einsparungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind eigentlich längst überfällig: Schließlich belegen viele Studien deren geringe Wirksamkeit.
Natürlich wirft das Sparpaket der Bundesregierung auch Fragen auf. Da finden sich diverse Vorhaben, die offenbar dem Prinzip Hoffnung entsprungen sind– zum Beispiel die "Globale Minderausgabe" von 5,6 Milliarden Euro, von der keiner weiß, wie sie realisiert werden soll. Vertrauen schaffen solche Vorhaben nicht. Auch die geplanten Änderungen bei der Energiesteuer sind unglücklich, möglicherweise gefährden sie ganze Branchen in ihrem Fortbestand. Enttäuschend ist auch, dass ein Subventionsabbau gar nicht stattfindet. Hier liegt unverändert ein großes Potential.
Dennoch muss man festhalten: Ein Kaputtsparen ist mit dem Sparpaket nicht verbunden. Das Problem ist vielmehr die Kleinteiligkeit des Programms. Sie verhindert, dass die Bürger wieder Vertrauen in die Finanzpolitik des Landes fassen. Mehr Mut, mehr Konsequenz und mehr Nachhaltigkeit wären möglich gewesen.

Stellungnahme für den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Landtags Schleswig-Holstein: Schuldenbremse und Investitionsquoten
Angesichts der bestehenden Herausforderungen, insbesondere der Transformation zur Klimaneutralität, erscheinen die bestehenden Grenzwerte der Schuldenbremse als zu eng. Dies gilt umso mehr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, in ...
IW
Schuldenbremse: Frische Impulse dank systematischer Steuerreformen
IW-Direktor Michael Hüther plädiert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für eine Ordnungspolitik, die endlich auf der Höhe der Zeit ist und neue Impulse für die Wirtschaft setzt. Sein Vorschlag: ein neuer Ausnahmetatbestand.
IW