Im Vergleich zu anderen Industrienationen fällt die Ungleichheit der Nettoeinkommen in Deutschland unterdurchschnittlich aus – dies geht vor allem auf eine starke staatliche Umverteilung zurück: Das Steuer-, Transfer- und Rentensystem reduziert die Ungleichheit der Markteinkommen um über 40 Prozent.
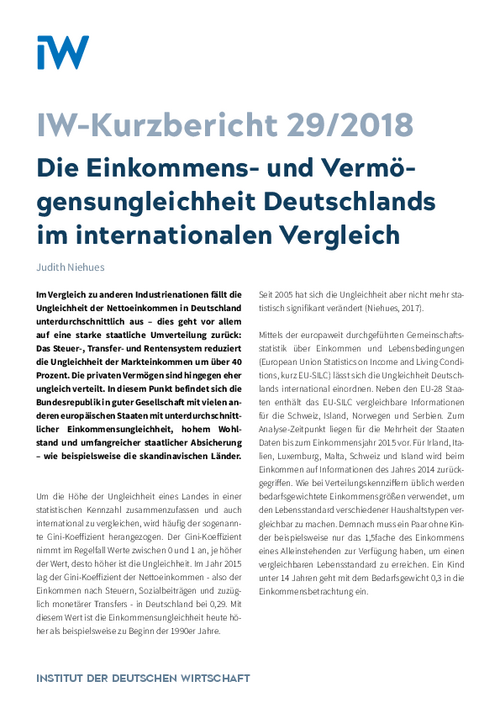
Die Einkommens- und Vermögensungleichheit Deutschlands im internationalen Vergleich

Im Vergleich zu anderen Industrienationen fällt die Ungleichheit der Nettoeinkommen in Deutschland unterdurchschnittlich aus – dies geht vor allem auf eine starke staatliche Umverteilung zurück: Das Steuer-, Transfer- und Rentensystem reduziert die Ungleichheit der Markteinkommen um über 40 Prozent.
Die privaten Vermögen sind hingegen eher ungleich verteilt. In diesem Punkt befindet sich die Bundesrepublik in guter Gesellschaft mit vielen anderen europäischen Staaten mit unterdurchschnittlicher Einkommensungleichheit, hohem Wohlstand und umfangreicher staatlicher Absicherung – wie beispielsweise die skandinavischen Länder.
Um die Höhe der Ungleichheit eines Landes in einer statistischen Kennzahl zusammenzufassen und auch international zu vergleichen, wird häufig der sogenannte Gini-Koeffizient herangezogen. Der Gini-Koeffizient nimmt im Regelfall Werte zwischen 0 und 1 an, je höher der Wert, desto höher ist die Ungleichheit. Im Jahr 2015 lag der Gini-Koeffizient der Nettoeinkommen - also der Einkommen nach Steuern, Sozialbeiträgen und zuzüglich monetärer Transfers - in Deutschland bei 0,29. Mit diesem Wert ist die Einkommensungleichheit heute höher als beispielsweise zu Beginn der 1990er Jahre. Seit 2005 hat sich die Ungleichheit aber nicht mehr statistisch signifikant verändert (Niehues, 2017).
Mittels der europaweit durchgeführten Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, kurz EU-SILC) lässt sich die Ungleichheit Deutschlands international einordnen. Neben den EU-28 Staaten enthält das EU-SILC vergleichbare Informationen für die Schweiz, Island, Norwegen und Serbien. Zum Analyse-Zeitpunkt liegen für die Mehrheit der Staaten Daten bis zum Einkommensjahr 2015 vor. Für Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Schweiz und Island wird beim Einkommen auf Informationen des Jahres 2014 zurückgegriffen. Wie bei Verteilungskennziffern üblich werden bedarfsgewichtete Einkommensgrößen verwendet, um den Lebensstandard verschiedener Haushaltstypen vergleichbar zu machen. Demnach muss ein Paar ohne Kinder beispielsweise nur das 1,5fache des Einkommens eines Alleinstehenden zur Verfügung haben, um einen vergleichbaren Lebensstandard zu erreichen. Ein Kind unter 14 Jahren geht mit dem Bedarfsgewicht 0,3 in die Einkommensbetrachtung ein.
Mit Gini-Koeffizienten der Nettoeinkommen von unter 0,25 erreichen Island, die Slowakei, Slowenien und Norwegen die geringste Einkommensungleichheit im EU-SILC. Auch Deutschland zählt zu der Gruppe mit unterdurchschnittlicher Ungleichheit der Nettoeinkommen; dies gilt besonders, wenn die Bevölkerungsgröße der betrachteten Länder berücksichtigt wird. Deutlich höher fällt die Einkommensungleichheit in Südeuropa und den baltischen Ländern aus. Die OECD Income Distribution Database erlaubt auch den Vergleich mit Ländern außerhalb Europas. Mit einem Gini-Koeffizienten von 0,39 sind die Einkommen in den USA beispielsweise deutlich ungleicher verteilt als in Deutschland und den meisten europäischen Ländern.
<iframe scrolling="no" src="https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/HTML/2018/Ungleichheit/ungleichheit.html" style="border: 0; width: 100%; height: 950px"></iframe>
Zu einem anderen Ergebnis für Deutschland kommt man, wenn nur die Markteinkommen betrachtet werden – also die Einkommen vor staatlicher Umverteilung durch Steuern, Sozialbeiträge, Transfers und gesetzlicher Renten. Mit einem Gini-Koeffizienten der Markteinkommen von rund 0,50 liegt Deutschland nahezu auf einem Niveau mit den USA. Die ähnlichen Werte gehen vor allem auf Unterschiede in den sozialen Sicherungssystemen zurück: Während viele Deutsche im Alter bereits eine gesetzliche Rente beziehen (die beim Konzept des Markteinkommens unberücksichtigt bleibt), arbeiten US-Amerikaner meist länger und erhalten somit noch ein Einkommen am Markt. Unter ansonsten gleichen Bedingungen gilt: Je höher die gesetzliche Absicherung im Alter, desto höher die Ungleichheit der Markteinkommen. Betrachtet man hingegen nur die Markteinkommen der Bevölkerung unter 60 Jahren liegt die Ungleichheit in den USA deutlich höher als in Deutschland (Gornick/Milanovic, 2015).
Insgesamt reduziert sich die Ungleichheit in Deutschland durch gesetzliche Renten, sonstige Sozialtransfers und nach Abzug der Einkommensteuer und Sozialbeiträge um über 40 Prozent, in den USA um weniger als ein Viertel. Auch im Vergleich zu den europäischen Staaten und anderen Industrienationen wird die Ungleichheit in Deutschland durch staatliche Umverteilung – gemessen als die absolute Differenz der Gini-Koeffizienten der Markteinkommen und der Gini-Koeffizienten der Nettoeinkommen - überdurchschnittlich stark reduziert.
Neben den laufenden Einkommen ist für die finanzielle Situation der Haushalte das jeweilige Nettovermögen – nach Abzug von Schulden - bedeutend. Um möglichst viele Länder vergleichen zu können, werden hier die Vermögensdaten des Global Wealth Databook der Credit Suisse (2017) herangezogen, die ebenfalls regelmäßig in die Oxfam-Berichte zur weltweiten Vermögensungleichheit einfließen. Es werden nur Länder mit mindestens zufriedenstellender Datenqualität bei den Vermögen berücksichtigt, für die jeweils Bilanzdaten und Informationen zur Schätzung der Verteilung vorliegen. Die Vermögen reicher und sehr reicher Haushalte werden bei den Vermögensdaten der Credit Suisse mittels der Randwerte aus der Forbes-Reichenliste hinzugeschätzt. Aktuell liegen fortgeschriebene Daten bis zum Jahr 2017 vor.
Inklusive der Hinzuschätzung hoher Vermögen liegt der Gini-Koeffizient der Nettovermögen in Deutschland bei 0,79, die vermögensreichsten 10 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen demnach bis zu 65 Prozent der Nettovermögen. Die Vermögen sind somit sehr viel ungleicher verteilt als die Einkommen. Teilweise geht die höhere Ungleichverteilung der Vermögen aber allein darauf zurück, dass die angesparte Vermögenshöhe deutlich stärker vom Lebensalter abhängt als die Einkommenshöhe (Niehues, 2015).
Auch im internationalen Vergleich liegt Deutschland allerdings mit einem Gini-Koeffizienten der Nettovermögen von knapp 0,8 eher auf den hinteren Rängen und wiederum in der Nähe des Werts der USA (0,86). Jedoch zeigt sich im Ländervergleich grundsätzlich eine in der Tendenz höhere Vermögensungleichheit in Ländern mit höherem Wohlstandsniveau: Der Korrelationskoeffizient des kaufkraftbereinigten Medianeinkommens und der Vermögensungleichheit beträgt für die berücksichtigten europäischen Länder 0,66.
Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit hängen indes nahezu nicht – und wenn überhaupt - negativ zusammen. Viele der europäischen Länder, die über eine unterdurchschnittliche Einkommensungleichheit und gleichzeitig einen hohen Lebensstandard verfügen, sind durch eine vergleichsweise ausgeprägte Ungleichverteilung der Vermögen gekennzeichnet. Auch Deutschland gehört zu dieser Ländergruppe (Grafik). Besonders hoch – und höher als in Deutschland – ist die Vermögensungleichheit in den eher einkommensgleichen skandinavischen Ländern Norwegen, Dänemark und Schweden. Hier deutet sich ein ähnlicher Zusammenhang wie bei der Ungleichheit der Markteinkommen an: Je höher die staatliche Absicherung in einem Land, desto höher in der Tendenz die Vermögensungleichheit. Bei umfangreicher sozialer Sicherung sind zum einen die Anreize zur privaten Vermögensbildung geringer; zugleich erschweren die zur Finanzierung erforderlichen Steuern und Abgaben den Vermögensaufbau.
Geringe Ungleichheitswerte beim Einkommen und Vermögen kombinieren hingegen die osteuropäischen Staaten Ungarn, Slowakei und Kroatien, die allerdings gleichzeitig ein im EU-Vergleich eher geringes Wohlstandsniveau aufweisen. Mit Sozialausgaben im Jahr 2015 von rund 18,2 Prozent des BIP in der Slowakei bis 21,1 Prozent in Kroatien fällt auch die soziale Absicherung dieser Länder deutlich unterdurchschnittlich aus. Zum Vergleich: In Deutschland flossen 2015 gemäß Eurostat 29 Prozent des BIP in den Sozialschutz.
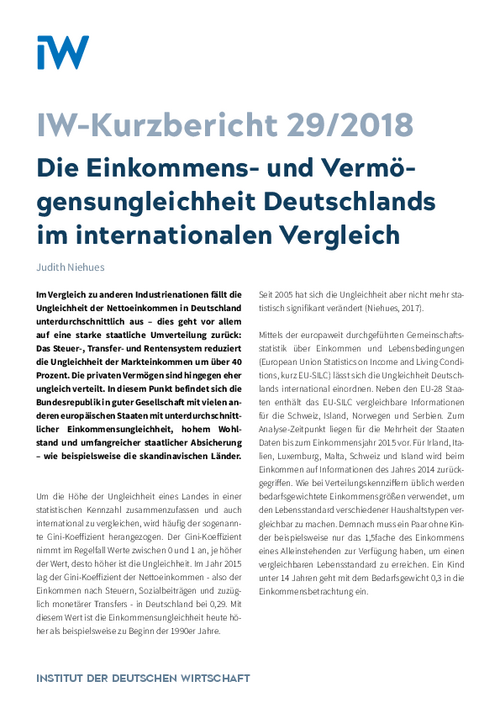
Die Einkommens- und Vermögensungleichheit Deutschlands im internationalen Vergleich


Wer im Alter arbeitet, ist zufriedener
IW-Expertin für soziale Sicherung und Verteilung, Ruth Maria Schüler, geht in einem Gastbeitrag für die Fuldaer Zeitung der Frage nach, warum der frühe Ausstieg aus dem Erwerbsleben kein Garant für das Lebensglück ist.
IW
Inflation: Rentner nicht stärker betroffen als andere Haushalte
Die Kaufkraft von Rentnern der Gesetzlichen Rentenversicherung sank in den vergangenen Jahren nicht stärker als bei anderen Haushalten. Während die Coronapandemie Rentner nicht so stark getroffen hat, führten die Preissteigerungen spätestens seit 2022 zu ...
IW