Vernetzt mit Wirtschaft und Gesellschaft, eingebettet in einen internationalen Austausch und flexibel auf die unterschiedlichen Interessen von Studierenden mit und ohne Berufserfahrung reagierend – so sollten die Hochschulen aufgestellt sein, um den Megatrends Digitalisierung, Internationalisierung und demographischer Wandel produktiv begegnen zu können.
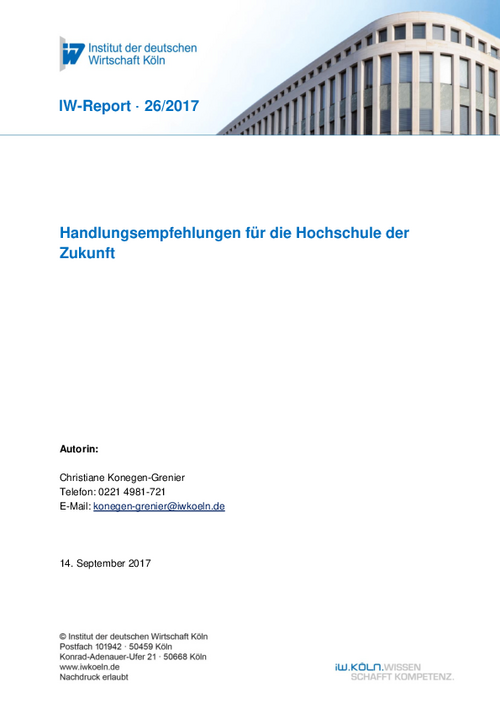
Handlungsempfehlungen für die Hochschule der Zukunft

Vernetzt mit Wirtschaft und Gesellschaft, eingebettet in einen internationalen Austausch und flexibel auf die unterschiedlichen Interessen von Studierenden mit und ohne Berufserfahrung reagierend – so sollten die Hochschulen aufgestellt sein, um den Megatrends Digitalisierung, Internationalisierung und demographischer Wandel produktiv begegnen zu können.
In der Forschung ist dank Exzellenzinitiative und Pakt für Forschung und Innovation ein bemerkenswertes Maß an Vernetzung und Internationalisierung erreicht worden – allerdings in erster Linie für die Universitäten. In die Fachhochschulen als Treiber des Wissenstransfers und als Garanten einer praxisbezogenen Hochschulausbildung muss künftig mehr investiert werden. Rückläufige Anteile bei den privaten Drittmitteln der Hochschulen verweisen darauf, dass die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft kein Selbstläufer ist. Eine steuerliche Förderung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollte diesen Trend korrigieren.
Anders als in der Forschung ist die Bilanz der Pakte für die Lehre weniger positiv: Die Studienabbruchsquote ist nach wie vor hoch, die Durchlässigkeit für Bewerber aus dem berufsbildenden System kommt nur langsam voran, der Praxis- und Berufsbezug ist immer noch unzureichend, flexible Angebote zum weiterbildenden Studium sind nach wie vor eher rar und die Auslandsmobilität stagniert. Hinzu kommen trotz der Mittelsteigerungen durch die Pakte etliche Finanzierungprobleme: Insbesondere in den MINT-Fächern sind die Ausgaben pro Studierenden gesunken und die Betreuungsrelationen schlechter geworden. Der Anteil der Grundfinanzierung, die die Länder den Hochschulen zur Verfügung stellen, ist zurückgegangen. Für die Sanierung von Hochschulen und Studentenwohnheimen fallen in den nächsten Jahren zweistellige Milliardenbeträge an. Damit sind nur die Finanzierungsdefizite der Vergangenheit umrissen. Hinzu kommt ein erheblicher, bislang noch kaum bezifferter Investitionsbedarf für die Digitalisierung. Das betrifft Hard- und Software für die Rechnerausstattung ebenso wie die Finanzierung der Vernetzung von Lernplattformen, vor allem aber auch die dauerhafte Finanzierung von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal für die Konzipierung, Installierung und Wartung digitaler Lern- und Forschungstools.
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen benötigen die Hochschulen sowohl mehr Mittel als auch im Bereich der Lehre mehr Anreize für die Behebung der nach wie vor bestehenden Defizite. Gleichzeitig erfordert der Aufbau einer technischen und personellen, digitalen Infrastruktur ein länderübergreifendes Vorgehen.
Der Bund sollte demzufolge nach Ende der Pakte sein finanzielles Engagement aufrechterhalten, aber auf eine finanzielle Mitbeteiligung der Länder nicht verzichten. Das finanzielle Engagement des Bundes sollte auf einer gemeinsamen Strategieentwicklung mit den Ländern basieren. Bund und Länder sollten einen Teil der Hochschulpaktmittel in einen Absolventenbonus umwidmen, der auch die Durchlässigkeit und internationale Mobilität berücksichtigt. Weitere Mittel aus vormaligen Wettbewerben sollten in eine deutsche Lehrgemeinschaft fließen, die Initiativen zur Verbesserung der Lehrqualität und der Entwicklung von digitalen Werkzeugen fördern sollte. Weitere Hochschulpakt- und Fördermittel sollten zum länderübergreifenden Aufbau einer technischen und personellen, digitalen Infrastruktur in das vom Wissenschaftsrat betreute, länderübergreifende Programm „Förderung von Forschungsbauten“ fließen.
Könnten die Kompensationsmittel für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und die wenig sinnhaften Ausgleichsmittel für die im Wettbewerb um Forschungsmittel weniger erfolgreichen Länder miteinbezogen werden, ergäbe sich für die Lehre ein Volumen von rund vier Milliarden Euro an jährlichen Bundesmitteln, welches durch eine obligatorische Beteiligung der Länder noch gesteigert werden könnte. Weitere 1,8 Milliarden können durch allgemeine Studiengebühren hinzukommen, selbst wenn die seinerzeit in Bayern üblichen Ausnahmeregelungen gelten würden. Damit wäre zusätzlich zum Absolventenbonus und zur Einrichtung einer Deutschen Lehrgemeinschaft ein weiterer Anreiz zur Verbesserung der Lehre geschaffen.
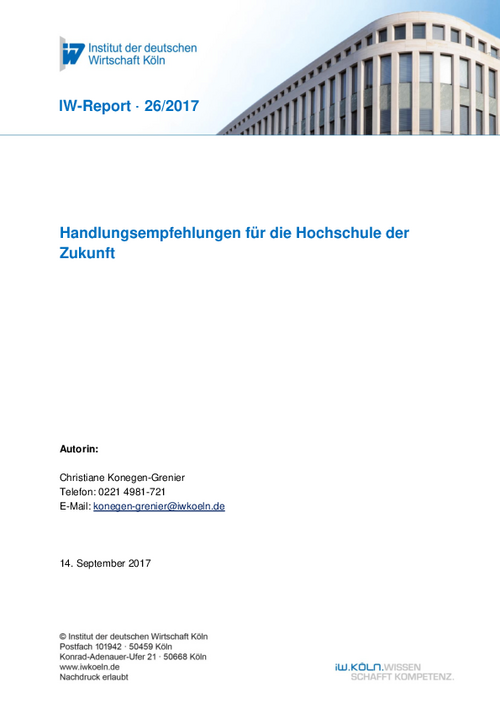
Handlungsempfehlungen für die Hochschule der Zukunft


Private Hochschulen in der Transformation – Employability aus Sicht der deutschen Wirtschaft
In Deutschland hat eine beträchtliche Expansion der Hochschulbildung stattgefunden. Besonders die privaten Hochschulen konnten dabei in den vergangenen 20 Jahren von einer Randposition ausgehend ein starkes Wachstum verzeichnen.
IW
Private Hochschulen: Unternehmen schätzen praxisnahe Ausbildung
Immer mehr Menschen studieren an privaten Hochschulen. Für die Unternehmen sind das gute Nachrichten, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Denn wer an einer privaten Hochschule studiert, arbeitet sich schneller ein – das hilft ...
IW