Die starke Zuwanderung der letzten Jahre hat zu einer deutlichen Verschiebung der demografischen Strukturen in Deutschland geführt. So wären die Zahl der 20- bis 29-Jährigen ohne die seit 2007 Zugewanderten im Jahr 2017 um 1,26 Millionen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung um 0,9 Prozentpunkte niedriger gewesen.
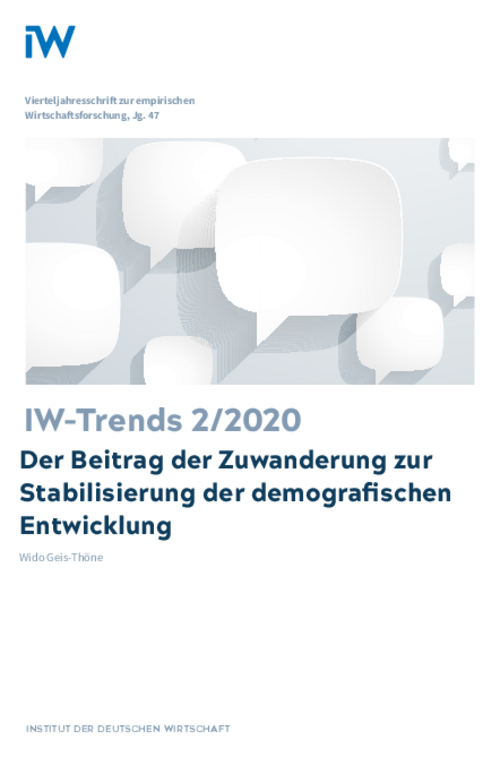
Der Beitrag der Zuwanderung zur Stabilisierung der demografischen Entwicklung
IW-Trends

Die starke Zuwanderung der letzten Jahre hat zu einer deutlichen Verschiebung der demografischen Strukturen in Deutschland geführt. So wären die Zahl der 20- bis 29-Jährigen ohne die seit 2007 Zugewanderten im Jahr 2017 um 1,26 Millionen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung um 0,9 Prozentpunkte niedriger gewesen.
Auch bei den 0- bis 9-Jährigen und den 30- bis 39-Jährigen zeigen sich durch die Neuzuwanderer und ihre in Deutschland geborenen Kinder deutliche Gewinne. Hingegen ergeben sich bei den 10- bis 19-Jährigen und den 40- bis 49-Jährigen keine maßgeblichen Veränderungen und bei den Älteren Rückgänge der Bevölkerungsanteile. Dabei besteht aus demografischer Sicht gerade bei den im Jahr 2017 im Teenageralter befindlichen Personen ein besonders großer Bedarf an Zuwanderern, da diese die geburtenstarken Jahrgänge am Arbeitsmarkt ersetzen müssen. Die Potenziale der Mobilität innerhalb der EU, die eine tragende Säule der Zuwanderung der letzten Jahre war, sind hier sehr begrenzt. Denn in den Herkunftsländern der europäischen Zuwanderer in dieser Altersgruppe bestehen ebenfalls große demografische Lücken. Daher muss die Zuwanderungspolitik ihren Fokus in den nächsten Jahren vermehrt auf demografiestarke Drittstaaten richten. Der Schwerpunkt sollte dabei auf der Erwerbs- und Bildungsmigration liegen, da das Gelingen der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt darüber entscheidet, welchen Beitrag die Zuwanderung zur Bewältigung der mit dem demografischen Wandel einhergehenden Herausforderungen tatsächlich leisten kann.
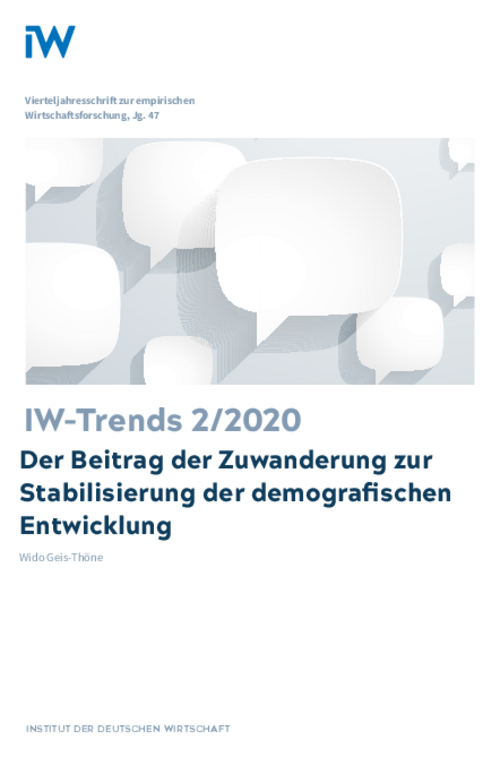
Wido Geis-Thöne: Der Beitrag der Zuwanderung zur Stabilisierung der demografischen Entwicklung
IW-Trends


KOFA Kompakt 4/2024: Ältere Beschäftigte am Arbeitsmarkt – wertvolle Erfahrung stärker als Potenzial nutzen
Durch den demografischen Wandel ist die Altersstruktur unter sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Ungleichgewicht. Da 6,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 55 Jahre oder älter sind, wird innerhalb der nächsten zehn Jahre ...
IW
Wer im Alter arbeitet, ist zufriedener
Trotz Krisen ist die Lebenszufriedenheit der deutschen Wohnbevölkerung in den letzten Jahren gestiegen. Dabei äußern ältere Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, im Durchschnitt eine höhere Lebenszufriedenheit als ältere Menschen, die dies nicht tun. ...
IW