Die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ist nach langwierigen Verhandlungen im Juni 2017 von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Mit der Fokussierung auf die Verteilung der zusätzlichen Bundesmittel ist die Chance vertan, den Föderalismus zu stärken.
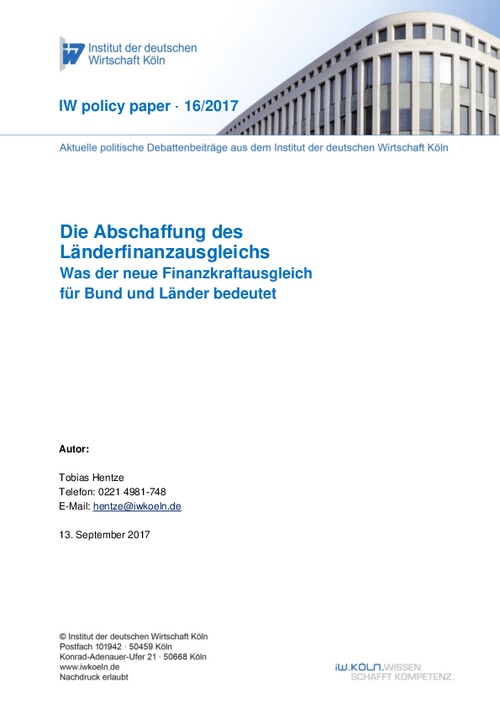
Die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs: Was der neue Finanzkraftausgleich für Bund und Länder bedeutet
IW policy paper

Die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ist nach langwierigen Verhandlungen im Juni 2017 von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Mit der Fokussierung auf die Verteilung der zusätzlichen Bundesmittel ist die Chance vertan, den Föderalismus zu stärken.
Der Begriff „Länderfinanzausgleich“ wird gesetzlich künftig durch den Begriff „Finanzkraftausgleich“ ersetzt. Ab dem Jahr 2020 wird jedes Bundesland zulasten des Bundes mehr Geld erhalten. Dies war eine zentrale Forderung der Ministerpräsidenten. Von 2020 bis 2030 wird der Betrag von anfänglich 9,7 Milliarden Euro auf mehr als 13 Milliarden Euro steigen. Denn 60 Prozent der zusätzlichen Bundesmittel unterliegen einer Dynamik, das heißt sie verändern sich Jahr für Jahr je nach Einnahmenentwicklung. Kumuliert verzichtet der Bund nach der Neuordnung von 2020 bis 2030 auf rund 140 Milliarden Euro zugunsten der Länder.
Die Neuordnung entspricht fast gänzlich dem Konzept der Ministerpräsidenten vom Dezember 2015. Dabei wird das bislang vierstufige Ausgleichssystem abgewandelt, indem der Umsatzsteuervorwegausgleich und der horizontale Finanzausgleich abgeschafft werden und stattdessen die Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen stärker für einen Ausgleich sorgen soll. Der Mechanismus wird so verändert, dass es künftig nicht mehr zu Zahlungen zwischen den Bundesländern kommt. Vielmehr wird die Verteilung der Umsatzsteuer genutzt, um Finanzkraftunterschiede auf eine weiterhin komplexe Art und Weise auszugleichen. Dabei stellen sich bessere Anreizeffekte im Sinne einer soliden Finanzpolitik nur für die Geberländer ein. Für die finanzschwachen Nehmerländer erhöhen sich die Grenzbelastungen dagegen sogar. Von zusätzlichen Lohnsteuereinnahmen müssen die Nehmerländer in der Regel mehr als 80 Prozent in den Topf des Finanzkraftausgleichs abgeben. Das liegt vor allem an der höheren Auffüllungsquote bei der letzten Stufe des Ausgleichssystems, den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ). Wenn reichere Länder größere Anreize haben als ärmere Länder, ihre Einnahmenseite zu verbessern, könnten Geber- und Nehmerländer fiskalisch noch weiter auseinanderdriften. Als Konsequenz müsste der Bund immer stärker eingreifen, um die Unterschiede zu begrenzen.
Mit der reinen Fokussierung auf die Verteilung der zusätzlichen Bundesmittel ist die Chance vertan, den Föderalismus zu stärken. Zielführend wäre es gewesen, bessere Anreize für eine nachhaltige Finanzpolitik zu setzen und mehr Eigenverantwortlichkeit in Form von Steuerautonomie für die Bundesländer einzuführen. Dies hätte den Bundesländern auch die Möglichkeit gegeben, eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass sie die ab 2020 geltende Schuldenbremse einhalten können. Denn trotz der zusätzlichen Einnahmen durch den neuen Finanzausgleich wachsen die Risiken auf der Ausgabenseite in den kommenden Jahren kräftig an.
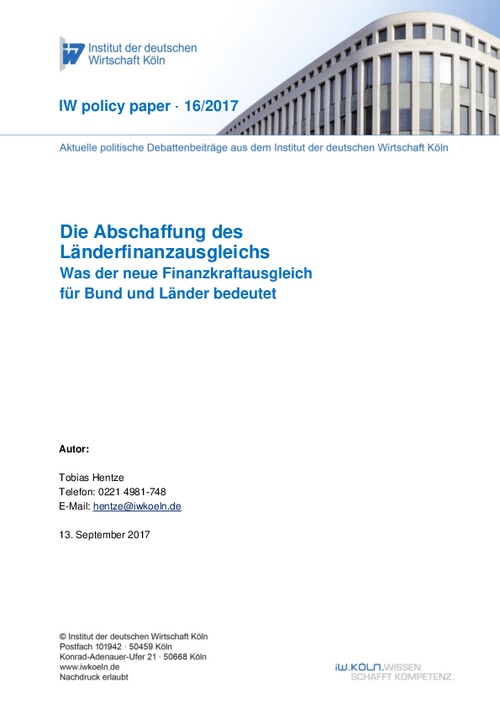
Tobias Hentze: Die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs – Was der neue Finanzkraftausgleich für Bund und Länder bedeutet
IW policy paper


Stellungnahme für den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Landtags Schleswig-Holstein: Schuldenbremse und Investitionsquoten
Angesichts der bestehenden Herausforderungen, insbesondere der Transformation zur Klimaneutralität, erscheinen die bestehenden Grenzwerte der Schuldenbremse als zu eng. Dies gilt umso mehr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, in ...
IW
Schuldenbremse: Frische Impulse dank systematischer Steuerreformen
IW-Direktor Michael Hüther plädiert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für eine Ordnungspolitik, die endlich auf der Höhe der Zeit ist und neue Impulse für die Wirtschaft setzt. Sein Vorschlag: ein neuer Ausnahmetatbestand.
IW