Die gute Nachricht der Europawahl ist: Die populistischen Antieuropäer verbleiben am Rande. Das Ergebnis ist dennoch kein gutes für die großen Volksparteien – sie mussten einige Verluste verbuchen, inklusive des Verlusts ihrer gemeinsamen politischen Mehrheit im Europaparlament.
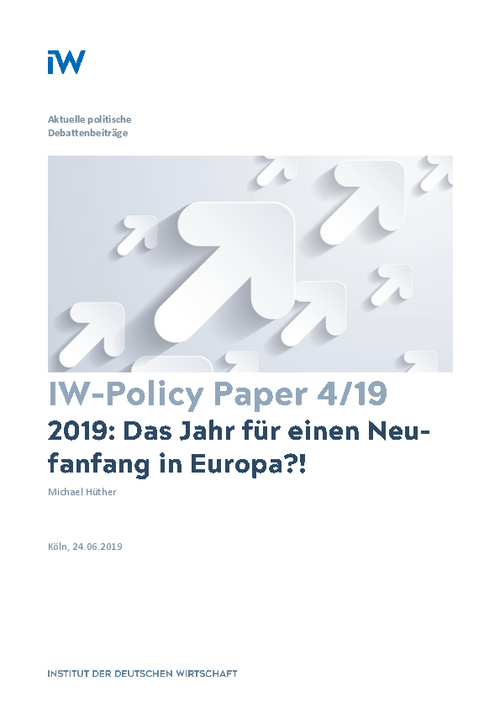
Chance für den Neuanfang: 2019 – Das Jahr für einen Neuanfang in Europa?!
IW-Policy Paper

Die gute Nachricht der Europawahl ist: Die populistischen Antieuropäer verbleiben am Rande. Das Ergebnis ist dennoch kein gutes für die großen Volksparteien – sie mussten einige Verluste verbuchen, inklusive des Verlusts ihrer gemeinsamen politischen Mehrheit im Europaparlament.
Künftig wird es mindestens dreier Parteien bedürfen, um eine Mehrheit zu generieren. Dadurch werden entweder die Liberalen oder die Grünen zum Zünglein an der Waage. Dabei sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die Entscheidungsfindung im Europäischen Parlament auch bisher durch immer wieder wechselnde, sachthemenabhängige Mehrheiten geprägt war und eher weniger durch fraktionsdisziplinarische Vorgaben. Die politische Debatte wird aber wohl dennoch pluralistischer werden. Bezüglich politischer Prioritäten ist zu erwarten, dass Klima- und Umweltthemen nach oben auf die Agenda rücken werden. Aber auch Sicherheitspolitik, von Migrationsfragen bis zum Kampf gegen Terrorismus, sowie die Reform der Eurozone und ihrer fiskalischen Regelungen gehören weiterhin zu den Topthemen.
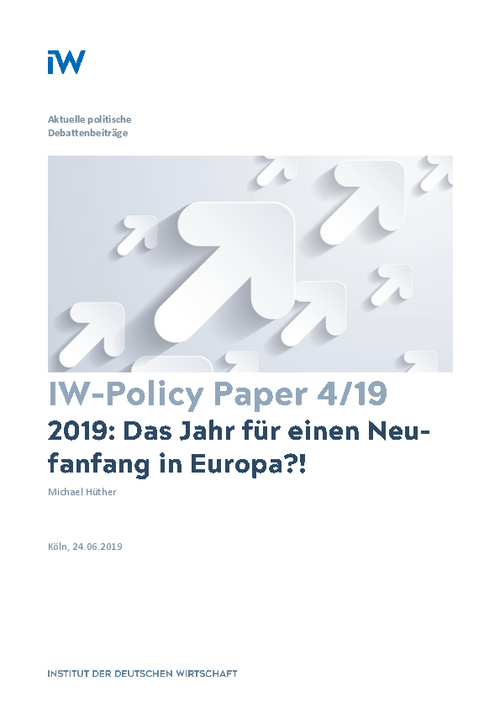
Michael Hüther: 2019 – Das Jahr für einen Neufanfang in Europa?!
IW-Policy Paper


Berliner Gespräche Frühjahrstagung: Zwischen Sicherheitspolitik, Green Deal und Wettbewerbsfähigkeit – eine europapolitische Bestandsaufnahme
Das Institut der deutschen Wirtschaft möchte Sie erneut zu einer virtuellen Variante der „Berliner Gespräche” einladen.
IW
Not so Different?: Dependency of the German and Italian Industry on China Intermediate Inputs
On average the German and Italian industry display a very similar intermediate input dependence on China, whether accounting for domestic inputs or not.
IW