Geldwertstabilität ist der Garant für eine nachhaltige und stabile Wirtschaftsentwicklung. Phasen der übermäßigen Geldentwertung untergraben das Vertrauen in die Kaufkraft und verursachen eine Umverteilung zwischen Schuldnern und Gläubigern. Die Geldpolitik der Zentralbanken zielt darauf ab, die Inflationsrate zu steuern.
- Home
- Themen
- Unternehmen und Märkte
- Geldpolitik
Geldpolitik

Über das Thema
Deshalb ist die Europäische Zentralbank (EZB) der Preisstabilität verpflichtet. Ihr Ziel ist es, die Inflationsrate mittelfristig knapp unter 2 Prozent zu halten. Zu den geldpolitischen Instrumenten der EZB gehört vor allem die Festsetzung des Leitzinses. Damit steuert die Zentralbank den Zinssatz am Interbankenmarkt, also dem Markt, auf dem sich die Banken untereinander Geld leihen oder sich von der EZB Geld leihe.
Eine lockere Geldpolitik erlaubt es Banken ihre Kreditvergabe an Staaten, Unternehmen und Haushalte auszuweiten. Die Herausforderung für die Zentralbank besteht darin, ihre Geldpolitik so zu wählen, dass nicht zu viel Geld in der Wirtschaft umläuft und Inflation entsteht.


33. Finanzmarkt Round-Table: De-Industrialisierung – Gefahr für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Deutschland?
Das Institut der deutschen Wirtschaft, die DekaBank und die Börsen-Zeitung laden Sie zum Finanzmarkt Round-Table am Montag, den 29. April 2024 von 10:30 bis 12:30 Uhr ein. Der Round-Table findet als Online-Veranstaltung statt.
Markus Demary IW

Tarifverhandlungen 2024: Es droht eine höhere Inflation
Im Frühjahr stehen weitere Tarifverhandlungen in der Chemie- und Baubranche sowie dem Bankwesen an. Beharren die Gewerkschaften auf ihre hohen Forderungen, könnte dies auch die Inflation wieder hochtreiben. Davor warnt eine neue Studie des Instituts der ...
Hagen Lesch IW

Die deutsche Lohnpolitik zwischen Inflation und Stagnation: Drohen Zielkonflikte mit der Geldpolitik?
Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise setzte ein Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt ein, der Spielraum für eine vergleichsweise expansive Lohnpolitik eröffnete.
Hagen Lesch IW

Finanzierung von Windenergie durch Investmentfonds
Am Beispiel der Finanzierung von Windenergie zeigt sich, wie Kapitalmarktinvestoren und Kleinanleger an der Finanzierung der Klimaneutralität beteiligt werden können. Die Europäische Union hat mit den European Long-Term Investment Funds (ELTIF) ein ...
Markus Demary IW
Unsere Experten

Dr. Markus Demary
Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik
Tel: 0221 4981-732 Mail: demary@iwkoeln.de Markus Demary
Jürgen Matthes
Leiter des Clusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte
Tel: 0221 4981-754 Mail: matthes@iwkoeln.de Jürgen MatthesAlle Beiträge
33. Finanzmarkt Round-Table: De-Industrialisierung – Gefahr für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Deutschland?
Das Institut der deutschen Wirtschaft, die DekaBank und die Börsen-Zeitung laden Sie zum Finanzmarkt Round-Table am Montag, den 29. April 2024 von 10:30 bis 12:30 Uhr ein. Der Round-Table findet als Online-Veranstaltung statt.
Markus Demary IW

Tarifverhandlungen 2024: Es droht eine höhere Inflation
Im Frühjahr stehen weitere Tarifverhandlungen in der Chemie- und Baubranche sowie dem Bankwesen an. Beharren die Gewerkschaften auf ihre hohen Forderungen, könnte dies auch die Inflation wieder hochtreiben. Davor warnt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).
Hagen Lesch IW

Die deutsche Lohnpolitik zwischen Inflation und Stagnation: Drohen Zielkonflikte mit der Geldpolitik?
Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise setzte ein Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt ein, der Spielraum für eine vergleichsweise expansive Lohnpolitik eröffnete.
Hagen Lesch IW
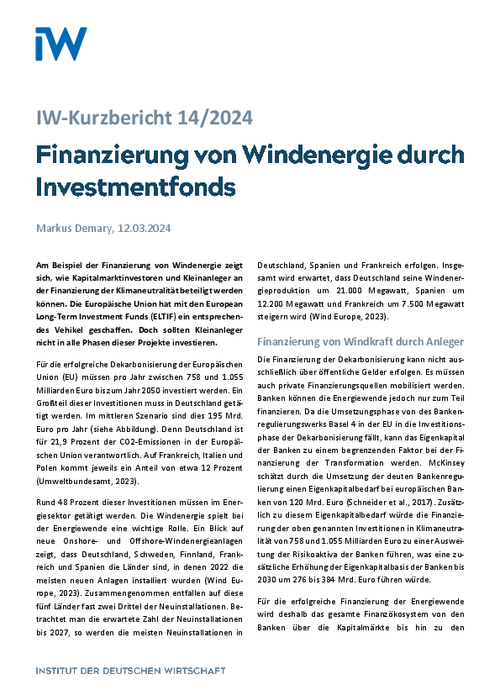
Finanzierung von Windenergie durch Investmentfonds
Am Beispiel der Finanzierung von Windenergie zeigt sich, wie Kapitalmarktinvestoren und Kleinanleger an der Finanzierung der Klimaneutralität beteiligt werden können. Die Europäische Union hat mit den European Long-Term Investment Funds (ELTIF) ein entsprechendes Vehikel geschaffen. Doch sollten Kleinanleger nicht in alle Phasen dieser Projekte investieren.
Markus Demary IW
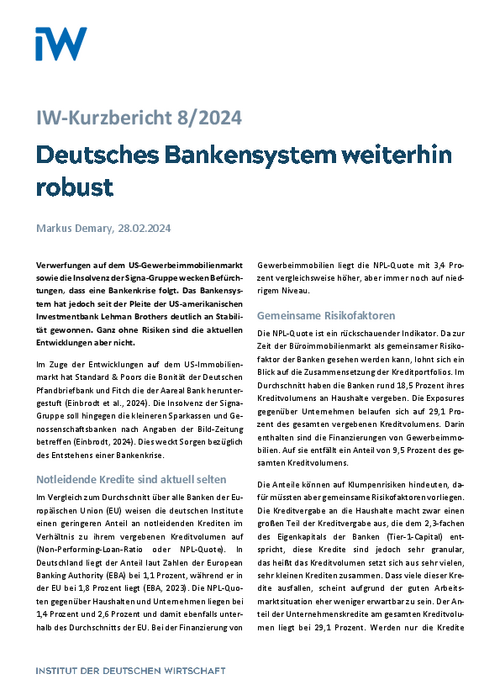
Deutsches Bankensystem weiterhin robust
Verwerfungen auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt sowie die Insolvenz der Signa-Gruppe wecken Befürchtungen, dass eine Bankenkrise folgt. Das Bankensystem hat jedoch seit der Pleite der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers deutlich an Stabilität gewonnen. Ganz ohne Risiken sind die aktuellen Entwicklungen aber nicht.
Markus Demary IW
Ihre Suche lieferte einen fehlerhaften Status zurück. Möglicherweise haben Sie zu viele Filter ausgewählt. Sie können zurück zu Ihrer vorherigen Auswahl springen, um Ihre Suche anzupassen.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.
Monatlich verschicken wir unsere themenspezifischen Newsletter.
Hier geht's zur Anmeldung.
Mit unseren monatlichen Newslettern zu den folgenden Themenbereichen verpassen Sie keine IW-Publikation mehr.

