Der Koalitionsgipfel hat beschlossen, die Steuerzahler in zwei Schritten um insgesamt 6 Milliarden Euro zu entlasten. Dazu soll vor allem bei der Einkommenssteuer der Grundfreibetrag um 350 Euro angehoben werden. Nach den Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln wären für diesen Schritt aber höchstens 2,5 Milliarden Euro nötig, sofern man alle anderen Tarifbestandteile unverändert lässt. Die Regierung hat aber mit 4 Milliarden Euro fast den doppelten Wert dafür eingeplant.
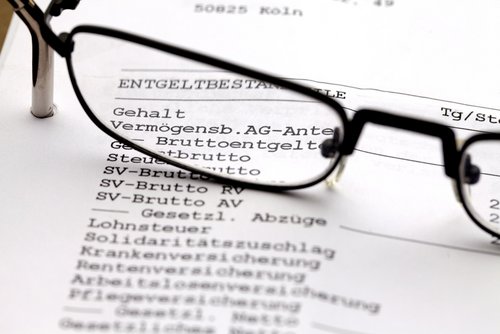
Entlastung mit Augenmaß
Die Bundesregierung möchte laut eigener Aussage 4 Milliarden Euro für die Anhebung des Grundfreibetrags verwenden. Die verbleibenden 2 Milliarden Euro sollen dazu eingesetzt werden, die übrigen Tarifgrenzen zu verschieben. Damit wird die kalte Progression ausgeglichen. Die Anhebung des Grundfreibetrags kostet den Fiskus aber nur rund 2 bis 2,5 Milliarden Euro. Welche zusätzlichen Maßnahmen geplant sind, um auf die 4 Milliarden Euro zu kommen, ist noch unbekannt.
Bleibt es bei 6 Milliarden Euro Entlastung durch alle Maßnahmen, zahlen die Steuerpflichtigen monatlich 15 bis 25 Euro weniger ans Finanzamt.
Mit dem Reformpaket hat die Bundesregierung einen vertretbaren Kompromiss zwischen steuerlicher Entlastung und Haushaltskonsolidierung gewählt. Denn ein höherer Grundfreibetrag wäre aufgrund der verfassungsrechtlich gebotenen Freistellung des Existenzminimums ohnehin 2014 nötig. Indem sie diese Anhebung vorzieht, hält sie den Grundfreibetrag aus dem Bundestagswahlkampf 2013 heraus. Gleichzeitig entstehen in den Jahren 2014 bis 2016, in denen der Bund sein strukturelles Defizit noch deutlich senken muss, um die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten, keine zusätzlichen Haushaltbelastungen.
Anders verhält es sich mit den jährlichen Mindereinnahmen aus dem Ausgleich der kalten Progression. Sie belasten zwar die öffentlichen Haushalte, sind aber vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung, die mittelfristig jährliche Mehreinnahmen von 5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr prognostiziert, verkraftbar. Bei diesem Wachstum der Steuereinnahmen können Bund, Länder und Gemeinden auf heimliche Steuererhöhungen verzichten, ohne dass die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder der Konsolidierungskurs leidet.

Schuldenbremse: Frische Impulse dank systematischer Steuerreformen
IW-Direktor Michael Hüther plädiert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für eine Ordnungspolitik, die endlich auf der Höhe der Zeit ist und neue Impulse für die Wirtschaft setzt. Sein Vorschlag: ein neuer Ausnahmetatbestand.
IW
Wachstumschancengesetz: Investitionen fallen nur sechs Milliarden Euro höher aus
Am Freitag entscheidet der Bundesrat über das Wachstumschancengesetz. Die abgespeckte Version dürfte die Wirtschaft nur geringfügig ankurbeln. Bis Ende des Jahrzehnts werden inflationsbereinigt sechs Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen ausgelöst, ...
IW